Thema
Gerechtigkeit in einer liberalen Gesellschaft
Vor 50 Jahren diskutierte die Welt über John Rawls’ „A Theory of Justice“. Seine Ideen sind heute wichtiger denn je. Am Ende einer Epoche ist die Rückbesinnung auf liberale Wert besonders wichtig.
Text: Karl-Heinz Paqué
Illustration: Emmanuel Polanco
Es ist das Jahr 1971, eine turbulente Zeit: In Deutschland regiert seit zwei Jahren eine sozialliberale Koalition, die Studentenunruhen der Achtundsechziger sind noch in frischer Erinnerung, die Schlussphase des Nachkriegsbooms ist eingeläutet, überall dreht sich die Spirale der Inflation, Preise und Löhne schießen nach oben, der Dollar als globale Leitwährung kommt unter massiven Druck. Dramatisches steht kurz bevor: Das Bretton-Woods-System fester Wechselkurse wird 1973 zusammenbrechen; ein Krieg im Nahen Osten wird einen dramatischen Höhenflug der Öl- und Rohstoffpreise auslösen, gefolgt von der bis dahin schwersten Rezession der Nachkriegszeit; ab 1975 herrscht chronische Arbeitslosigkeit, die über Jahrzehnte erhalten bleibt. Und all dies nur wenige Jahre nach dem Bericht zu den Grenzen des Wachstums, den der Club of Rome 1972 vorgelegt hatte – mit düsteren Prognosen, die den Startschuss für die globale Umweltbewegung liefern.
Fruchtbarer Aufbruch
Es ist Krisenzeit. Überall wird fieberhaft nachgedacht, wie es weitergehen kann. Symptom des Aufbruchs in eine neue Zeit mit ihren Herausforderungen sind in Deutschland die Freiburger Thesen der FDP. Sie entwerfen einen Liberalismus, der die Zukunftsaufgaben der Gesellschaft in Angriff nehmen soll – und nicht auf Bestehendem beharrt. Im gleichen Jahr publiziert im fernen Harvard ein angesehener Professor der Philosophie namens John Rawls einen dicken Wälzer, dem eigentlich nur die Fachwelt mit Spannung entgegensieht. Der Titel: „A Theory of Justice“. Völlig überraschend wird das Buch zu einem internationalen Bestseller, die deutsche Übersetzung erscheint 1975. Es wird plötzlich überall darüber diskutiert – in den Universitätsseminaren quer durch die rechts-, wirtschafts-, sozial- und humanwissenschaftlichen Fakultäten, aber auch und vor allem in der breiten medialen und politischen Öffentlichkeit. Der Grund ist einfach: John Rawls führt sein Fach nach jahrzehntelanger Dominanz der analytischen Philosophie an die frische, zugige Luft des politischen Diskurses: heraus aus dem Elfenbeinturm und hinein in die zentralen Grundfragen der Gesellschaft nach Wachstum und Verteilung der Ressourcen sowie Fairness und Gerechtigkeit der ökonomischen Ergebnisse. So ist jedenfalls im Nachhinein der Eindruck, den die lange Spur der Debatten hinterließ – bis tief in die Achtzigerjahre, als das Interesse langsam abebbte.
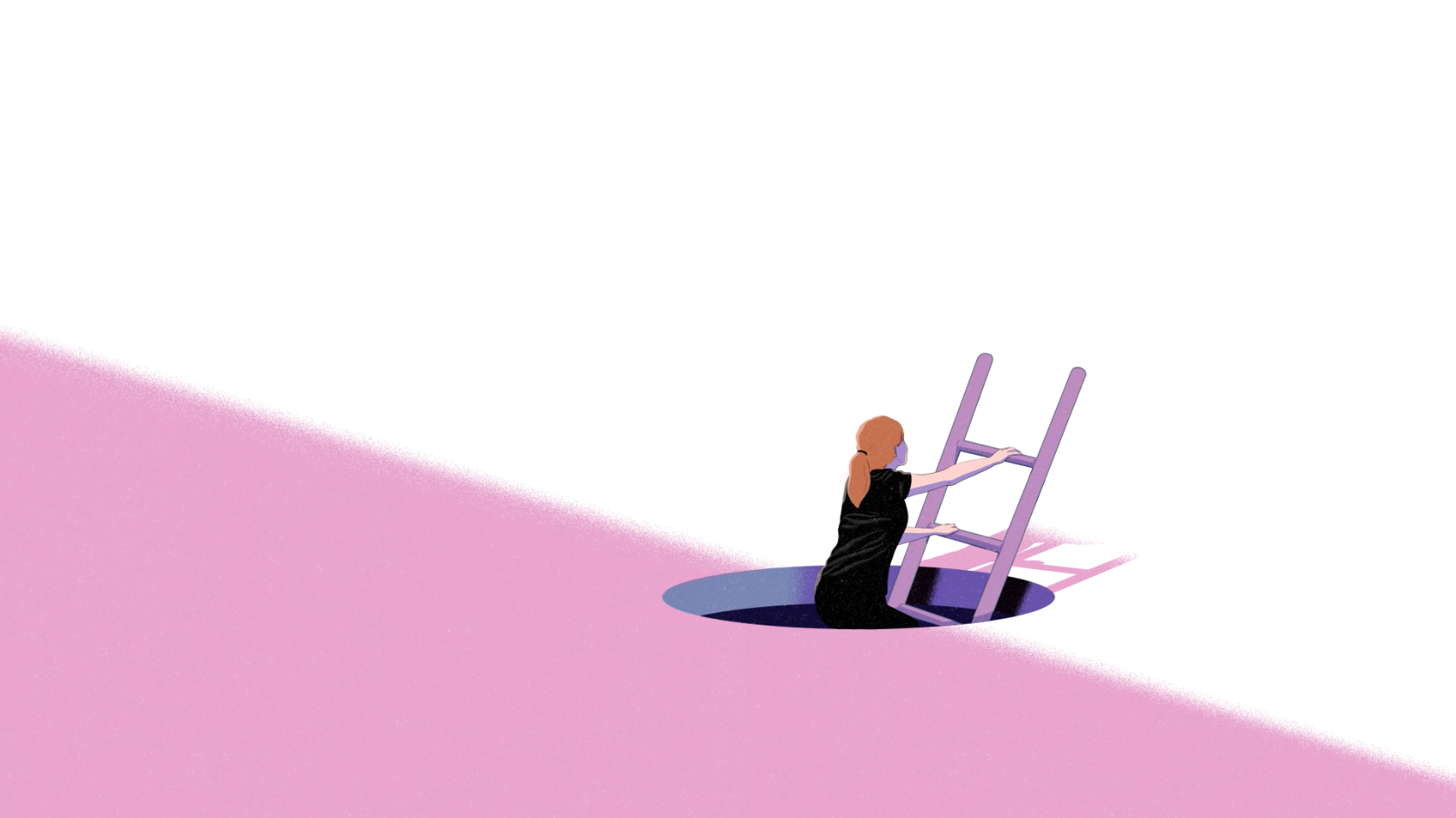
Rawls’ Theorie liefert keine Handlungsempfehlungen, sondern einen Rahmen für die politische Debatte.
Den politischen Nerv der Zeit getroffen
Für diesen „Hype“ war der zurückhaltende John Rawls persönlich überhaupt nicht verantwortlich. Denn sein Buch ist nicht nur umfangreich im Volumen, sondern auch extrem penibel in der Argumentation und alles andere als leicht zu lesen. Die Ursache für die enorme Resonanz liegt tiefer: Rawls traf den politischen Nerv seiner Zeit, einer Epoche des Umbruchs. Unter amerikanischer Ägide hatte die westliche Welt zwei Dekaden der Prosperität hinter sich – mit einer Geschwindigkeit des technischen Fortschritts und des wirtschaftlichen Wachstums, die alles in den Schatten stellte, was es bisher in der Menschheitsgeschichte gegeben hatte. Eine junge Generation stellte die Frage, ob und, wenn ja, wie dies weitergehen könne. Und sie forderte neue Leitbilder einer gerechten Gesellschaft. Manche glaubten, diese im Marxismus zu finden, und sie stellten lautstark ihre Forderungen nach einem revolutionären gesellschaftlichen Neuanfang. Andere suchten im Stillen nach neuer Orientierung – ohne Helden, aber mit intellektuellen Vorbildern. Die hießen nicht Marx und Lenin, sondern Ralf Dahrendorf und eben John Rawls.
Gibt es Parallelen zu heute? Sie liegen eigentlich auf der Hand. Wieder geht eine Epoche zu Ende, in Deutschland politisch die „Ära Merkel“, global die drei Jahrzehnte erfolgreicher Integration, in denen große Schwellenländer wie China und Indien sowie die vormals sowjetisch dominierten Nationen Osteuropas (und Ostdeutschland!) ihren Platz in der Weltwirtschaft gefunden haben. Nach Weltfinanzkrise und Coronaschock sehen wir tiefe Bremsspuren und fragen uns, wie wir die Gesellschaft der Zukunft aufstellen können. Und wieder gibt es eine Zweiteilung der Jugend, wie vor 50 Jahren: lautstarke Schuldzuweisungen und Forderungen der neuen weltumspannenden Bewegung „Fridays for Future“ und daneben eine stille Mehrheit, die ins Grübeln kommt und nach neuen Lösungen der Gerechtigkeit sucht.
Hinter dem Schleier der Unwissenheit
Und genau da ist John Rawls’ Theorie einschlägig. Seine Grundidee überzeugt auch heute noch: Eine Gesellschaft, in der die Menschen ohne Kenntnis ihres jeweiligen konkreten Schicksals über grundlegende Prinzipien des Zusammenlebens entscheiden müssten, würde hinter diesem Schleier der Unwissenheit („veil of ignorance“) für zwei Prinzipien votieren. Das eine wäre die maximale gleiche individuelle Freiheit für jeden (nennen wir es das „Freiheitsprinzip“). Das andere wäre das Zulassen von Ungleichheiten nur in dem Maße, wie diese Ungleichheit jedermann zugutekommt, insbesondere den am schlechtesten gestellten Mitgliedern der Gesellschaft (das „Differenzprinzip“). Diese beiden Prinzipien zusammen garantieren „Gerechtigkeit als Fairness“, eben weil sie mit unseren wohlüberlegten sozialethischen Urteilen übereinstimmen. Für Liberale ist das Freiheitsprinzip unproblematisch. Es liefert nicht mehr und nicht weniger als ein Grundpostulat des Liberalismus – eingebettet in eine sozialverträgliche Konzeption, die überzeugt: Wer überhaupt bereit ist, unparteiisch zu urteilen, also ohne Berücksichtigung seiner eigenen (geerbten?) Position und Privilegien, der kann eigentlich gar nicht anders, als allen Mitgliedern der Gesellschaft einschließlich sich selbst die maximale Freiheit zu wünschen. Viel komplizierter liegen die Dinge bei dem Differenzprinzip, das seinerzeit den Großteil der Debatten über Rawls’ Theorie auslöste. Es klingt zunächst für Liberale extrem egalitär: Jede Einkommens- und Vermögensungleichheit in einer Gesellschaft müsste danach daraufhin geprüft werden, ob sie nötig ist, um anderen Mitgliedern der Gesellschaft – insbesondere den Schwächsten – zu helfen, ihre Position zu verbessern. Wenn nicht, handelte es sich nach Rawls um ein ungerechtfertigtes Privileg und könnte einer hohen Besteuerung anheimfallen. Vor allem vielen libertären Philosophen und Ökonomen gefiel diese Konsequenz nicht, und sie opponierten deshalb scharf gegen das rawlssche Differenzprinzip.
Ein Hoch der Meritokratie!
Zu Unrecht. Denn sie verkannten, dass Rawls nichts anderes tut, als die Grundidee der meritokratischen Marktwirtschaft auf die logische Spitze zu treiben. In ihr rechtfertigt sich zum Beispiel das (gegebenenfalls hohe) Einkommen von Unternehmerinnen und Unternehmern letztlich genau dadurch, dass sie Güter, Dienstleistungen und Arbeitsplätze bereitstellen, die anderen Menschen helfen, ihre Lage zu verbessern: durch höhere Löhne, niedrigere Preise und/oder mehr, neue, differenziertere und qualitativ höherwertige Produkte. Gerade die Marktwirtschaft ist also das Vehikel, um den Wohlstand zu verbreiten, selbst wenn dadurch eine ungleiche Verteilung entsteht, solange diese Ungleichheit über das Verdienst („Merit“) für die breitere Gesellschaft zustande kommt.
Wo die Grenze der Reichweite dieses Verdienstes liegt, darüber lässt sich mangels präziser empirischer Anhaltspunkte natürlich trefflich streiten. Und genau dies ist der typische Gegenstand zwischen radikalen linken Forderungen für progressivere Besteuerung und scharfem libertärem Widerstand dagegen. Beispiele dafür gibt es zuhauf, geradezu klassisch im Bereich des Patentschutzes. So hat die junge Pharmafirma Biontech 2020 einen Impfstoff entwickelt, der wirksam hilft, die Coronapandemie zu bekämpfen. Wie viel des zusätzlichen Einkommens der Biontech-Kapitaleigner ist nun meritokratisch gerechtfertigt im Sinne von Rawls und wie viel nicht? Ähnliches gilt in Fragen der Erbschaftbesteuerung, soweit sie das in Betrieben gebundene Vermögen betrifft. Ist dieses Vermögen und die durch sie geschaffene Ungleichheit der Verteilung dadurch gerechtfertigt, dass hochproduktive Arbeitsplätze und die Herstellung hochinnovativer Produkte gesichert werden?
Sozialer Wert wirtschaftlicher Aktivität
Offensichtlich stößt man hier schnell an die Grenzen des vernünftigen philosophischen Diskurses und steckt mitten in der politischen Auseinandersetzung, leider mit nur wenig „Beweismitteln“ auf beiden Seiten der Argumentation. Deshalb liefert Rawls’ Theorie eigentlich nicht mehr als einen meritokratischen Ansatz, um über Verteilungsfragen überhaupt rational diskutieren zu können. Sie liefert keine Handlungsempfehlungen – weder linke noch libertäre, sondern einen Rahmen für die politische Debatte. Der allerdings ist außerordentlich fruchtbar, gerade weil er die Frage stellt, ob das Eigentum einen sozialen Wert hat, der über den individuellen Nutzen des Eigentümers hinausgeht.
Tatsächlich liegt hier eine der ganz großen Zukunftsfragen für unsere soziale Marktwirtschaft, insbesondere mit Blick auf die Nachhaltigkeit unserer wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung. Denn fragt man nach dem „sozialen Wert“ wirtschaftlicher Aktivität, so muss natürlich auch das Wohl der künftigen Generationen mit in den Blick genommen werden. Es geht auch und vor allem um intertemporale Fairness, und zwar über lange Zeiträume. Im Grunde braucht es einer umfassenden Generationenbilanz, die sowohl den Wert des materiellen und immateriellen Kapitalstocks als auch die Umwelt- und Klimabilanz sowie den Grad öffentlicher Verschuldung einbezieht. All dies hat Rawls seinerzeit weitgehend außer Acht gelassen, im Geist der frühen Siebzigerjahre. Heutzutage muss dies ganz anders sein – nach 50 Jahren Entwicklung von Infrastruktur und Innovationskraft unserer Wirtschaft, aber auch angesichts des von Menschen verursachten Klimawandels sowie steigender Staatsschulden, die auf den Schultern künftiger Generationen lasten.
Globale Theorie der Gerechtigkeit
Das meritokratische Bild des John Rawls ist also nochmals erheblich komplexer geworden, als es zu seiner Zeit erschien. Das macht die politische Aufgabe noch schwieriger als früher. Es geht um Arm und Reich, aber nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen. Aber der philosophische Rahmen der Gerechtigkeit ist unverändert, jedenfalls soweit man sich zum Ziel einer meritokratischen Gesellschaft bekennt.
Sollten Liberale das tun? Meine Antwort lautet: ja, auf jeden Fall. Es war schon im 19. Jahrhundert ein zentrales Ziel des Liberalismus, Privilegien in der Gesellschaft zu beseitigen. Damals ging es um klar erkennbare ständische Vorrechte; heute geht es um verdeckte Vorteile wie monopolistische Machtpositionen, öffentliche Beziehungsgeflechte und Zugang zu besserer Bildung. Da kommt es schon darauf an, dass eine Gesellschaft offen ist und bleibt. Und es ist wichtig, dass wirtschaftliches Wachstum inklusiv ausfällt, also nicht nur wie beispielsweise im oligarchischen Russland einer kleinen Elite zugutekommt.
Global gesehen gibt es übrigens in dieser Hinsicht keinen Grund zum Pessimismus: Das enorme wirtschaftliche Wachstum der zurückliegenden Jahrzehnte ist in hohem Maße den ärmeren Teilen der Welt zugutegekommen, ganz im Sinne von John Rawls. Der privilegierte Westen hat seine dominante Position eingebüßt. Im Kampf gegen Hunger und Armut gab es mächtige Fortschritte – allerdings nur dort, wo die Integration in die Weltwirtschaft funktionierte, am besten in großen Teilen des bevölkerungsreichen östlichen und südlichen Asiens, viel weniger gut in Afrika. Es bleibt deshalb eine große Aufgabe für die Zukunft, im Sinne einer globalen „Theorie der Gerechtigkeit“ nach John Rawls den Prozess der Integration wirklich inklusiv zu gestalten – durch weitere Öffnung der Weltmärkte, marktwirtschaftliche Reformen in den betroffenen Ländern und eine kluge Entwicklungspolitik des Westens.
Karl-Heinz Paqué
ist Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und Professor der Volkswirtschaftslehre. Er gehörte in den Siebziger- und Achtzigerjahren zu jener „stillen“ Generation Studierender, die sich intensiv mit der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls beschäftigte.
