Resilienz & Perspektiven
Sensible Zerstörung
Durch die zunehmende Gleichheit nehmen wir Unterschiede zwischen Menschen immer sensibler wahr. Doch inzwischen droht diese Sensibilität in Destruktion umzuschlagen: Sie vereint nicht mehr, sondern splittert die Gesellschaft in Gruppen auf und nimmt totalitäre Züge an.
TEXT: SVENJA FLASSPÖHLER

Resilienz & Perspektiven
Sensible Zerstörung

Durch die zunehmende Gleichheit nehmen wir Unterschiede zwischen Menschen immer sensibler wahr. Doch inzwischen droht diese Sensibilität in Destruktion umzuschlagen: Sie vereint nicht mehr, sondern splittert die Gesellschaft in Gruppen auf und nimmt totalitäre Züge an.
TEXT: SVENJA FLASSPÖHLER
Gleichheit macht Menschen stark: So könnte man glauben. Gleiche Rechte und erweiterte Möglichkeitsräume erzeugen widerstandsfähige (resiliente) Persönlichkeiten, die sich über noch existierende Ungleichheiten im Alltag erheben und aus dieser Höhe souverän zu handeln vermögen. Wir dürften uns dann zum Beispiel eine Frau vorstellen, die stolz auf den Schultern ihrer feministischen Vorkämpferinnen steht und sexistische Anwürfe selbstbewusst von sich fernzuhalten weiß, um sich Wichtigerem zuzuwenden.
Wenn man sich die zeitgenössische Dynamik genauer anschaut, ist allerdings offenbar das Gegenteil der Fall. Nicht die Stärke, sondern die Verletzlichkeit nimmt zu. Nicht Resilienz, sondern Empfindsamkeit - wenn nicht gar Empfindlichkeit - gibt den Ton an. Eine sensible Sprache, erhöhte Wachsamkeit für diskriminierendes Verhalten und eine sich zunehmend verfeinernde Strukturkritik ziehen die Grenze des Zumutbaren immer enger. Bereits ein Wort, ein filmisches Werk oder ein Bild, das schmerzhafte Assoziationen weckt, vermag Menschen demnach zu „retraumatisieren“. Im Zentrum dieser Entwicklung steht ein sensibles Selbst, das vor Verletzungen geschützt werden muss wie eine offene Wunde vor Infektionen.
Paradoxale Entwicklungen in den modernen Gesellschaften
Eine wegweisende Erklärung für diese paradoxale Entwicklung, die sich in den modernen Gesellschaften gerade vollzieht, findet sich in dem Werk des französischen Historikers und Philosophen Alexis de Tocqueville (1805–1859). Je gleicher die Menschen werden und je gerechter es in einer Gesellschaft zugeht, desto stärker nimmt die Sensibilisierung für noch bestehende Differenzen zu: Diese Beobachtung machte er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. „Sind alle gesellschaftlichen Bedingungen ungleich, so verletzt keine noch so große Ungleichheit den Blick des Betrachters; inmitten allseitiger Gleichförmigkeit dagegen wirkt die kleinste Verschiedenheit anstößig. Der Anblick wird umso unerträglicher, je weiter die Gleichförmigkeit fortgeschritten ist“, schreibt er in seinem 1835 erschienenen umfangreichen Bericht „Über die Demokratie in Amerika“.

Gleiche Rechte bedeuten nicht Gerechtigkeit
Anders als manch heutige Libertäre zeigte sich Tocqueville, der adeliger Herkunft war, keineswegs blind für strukturelle Probleme. Vielmehr erkennt der Denker sehr klar, dass gleiche Rechte (beispielsweise von Schwarzen und Weißen) noch nicht Gerechtigkeit bedeuten, weil die „Tyrannei der Mehrheit“ ebendiese zu verhindern weiß. Als Beispiel beschreibt Tocqueville eindrücklich, wie die weiße Mehrheit Schwarze mit Gewalt von den Wahllokalen fernhält. Das klingt noch heute vertraut.
Sensibel zu sein für solche Dynamiken, die sich unterhalb der rechtlichen Schwelle abspielen, muss als eine ausdrückliche Forderung Tocquevilles verstanden werden. Sie hat sich angesichts unterschwellig fortwirkender gesellschaftlicher Schieflagen auch nicht erübrigt. Wer zum Beispiel Rassismus nur dadurch zu bekämpfen versucht, dass er die betroffenen Menschen individuell zu mehr Resilienz auffordert („Nicht die Welt muss sich ändern, sondern du“), läuft Gefahr, rassistische Strukturen der Gesellschaft zu stabilisieren, statt sie aufzulösen.
Der historische Blick zeigt entsprechend, wie zentral eine erhöhte Empfindsamkeit für den menschlichen Fortschritt ist. Kein Kampf um Anerkennung wäre je ohne stetige Ausweitung der Empathie, ohne Sensibilisierung für das Leiden anderer, gewonnen worden. Der Soziologe Norbert Elias (1897-1990) hat nachgewiesen, wie unauflöslich eine zunehmend empfindsame Welt- und Selbstwahrnehmung mit dem „Prozeß der Zivilisation“ zusammenhängt. Und ähnlich wie Tocqueville hundert Jahre zuvor erkannte auch er, dass gerade der Feinsinn für Nuancen ein Ausweis zivilisatorischen Fortschreitens ist.
So schreibt Elias in seinem 1939 veröffentlichten Werk „Über den Prozeß der Zivilisation“: „Je mehr die starken Kontraste des individuellen Verhaltens sich abschwächen, je mehr die großen und lauten Ausbrüche von Lust oder Unlust durch Selbstzwänge zurückgehalten, gedämpft und gewandelt werden, umso größer wird die Empfindlichkeit für Schattierungen oder Nuancen des Verhaltens, umso sensibler werden die Menschen für kleinere Gesten und Formen, umso differenzierter erleben die Menschen sich selbst und ihre Welt in Schichten, die zuvor durch den Schleier der ungedämpften Affekte hindurch nicht ins Bewußtsein drangen.“
Angesichts des immensen Sensibilisierungsschubs der zurückliegenden Jahre muss man nun allerdings feststellen: Wir befinden uns heute an einem heiklen Kipppunkt, an dem die Produktivität dieser Empfindsamkeit in Destruktivität umzuschlagen droht. Die Sensibilität vereint nicht mehr, sie splittert die Gesellschaft in Gruppen, schreibt Menschen in Opferpositionen fest und nimmt inzwischen selbst totalitäre Züge an. Das Kernproblem liegt in einer Verabsolutierung der Sensibilität, die in einen Anti-Resilienz-Imperativ mündet: Nicht du musst dich ändern, sondern allein und ausschließlich die Welt um dich herum. Wer sich den nach diesem Prinzip geforderten gesellschaftlichen Transformationsprozessen nicht fügen mag, bekommt dann allzu rasch den Stempel „reaktionär“ aufgedrückt.
Sensibilität und Resilienz in Symbiose
Angesichts des zivilisatorischen Niveaus, das wir in westlichen Industrienationen des 21. Jahrhunderts erreicht haben, ist dieser Imperativ so falsch und so gefährlich wie sein genaues Gegenteil, das Fehlen jeglicher Empfindsamkeit. Vielmehr müssen wir anfangen, Sensibilität und Resilienz als Bündnis zu denken, was auch bedeutet, die Widerstandskraft vom Ruch toxischer Männlichkeit zu befreien.
Tatsächlich waren es die zwischen den beiden Weltkriegen gepflegten, von dem Kulturwissenschaftler Helmut Lethen sogenannten „Verhaltenslehren der Kälte“, die verworfen werden mussten, damit es möglich wurde, nach der Gründung der Bundesrepublik den Faden des Fortschritts wieder aufzunehmen. Mit soldatischer Verpanzerung, einer Schmerzunempfindlichkeit im Stile des Schriftstellers Ernst Jünger und verheerender Opfer-Verantwortung (du bist nicht hart genug und also selber schuld) wollte man zu Recht nichts mehr zu tun haben.
Diese Verhaltenslehren zu verwerfen, hatte höchste historische Berechtigung. Doch hat man, so erscheint es heute, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Wer zum Beispiel die Werke Jüngers genau liest, entdeckt unterhalb der Kriegsverherrlichung auch Beschreibungen einer inneren Abwehrkraft des Menschen, die sich gerade in Momenten höchster Ohnmacht entbindet. Diese Erkenntnis wurde für die psychoanalytische Behandlung von traumatisierten Kriegsrückkehrern wesentlich. An ihr zeigt sich, dass Verletzlichkeit und Resilienz in Wahrheit durchaus keine Gegensätze, sondern dialektisch miteinander verschränkt sind.
Wenn Tocqueville also recht hatte mit seiner Diagnose, dass die Sensibilität mit fortschreitender Gleichheit nicht ab-, sondern zunimmt, dann muss ihr die Resilienz an die Seite gestellt werden. Die Resilienz ist nicht die Feindin, sondern die Schwester der Sensibilität. Die Zukunft meistern können sie nur gemeinsam.
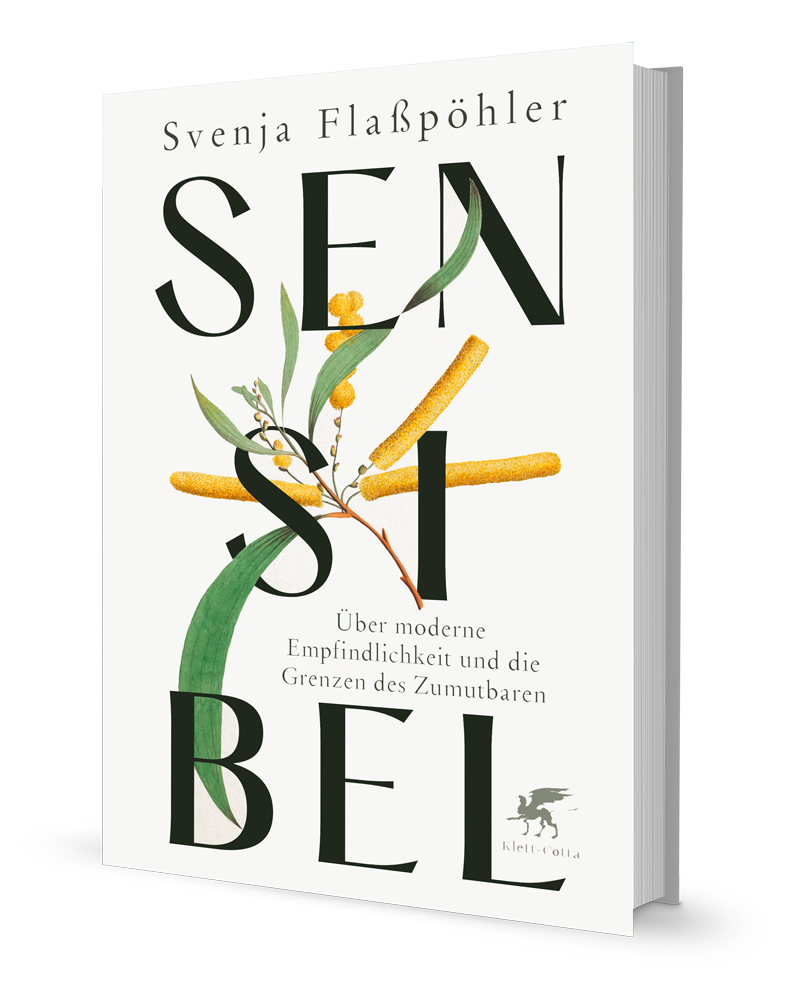
Am 20. Oktober erschien bei Klett-Cotta Svenja Flaßpöhlers neues Buch Sensibel. Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren.

Svenja Flaßpöhler ist Philosophin, Journalistin und Autorin. Seit 2018 ist sie Chefredakteurin des „Philosophie Magazins“. Beim Deutschlandfunk Kultur war sie leitende Redakteurin für Literatur- und Geisteswissenschaften und moderierte die Philosophie-Sendung „Sein und Streit“. Sie lebt in Berlin.
