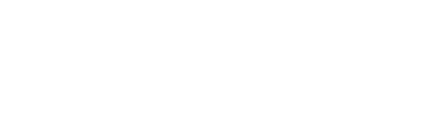Demokratie und Freiheit
Der neue Präsident ist kein Betriebsunfall
Die Constitution, die Verfassung der USA, bevorzugt ländliche und dünner besiedelte Bundesstaaten. Das hat Auswirkungen auf die liberalen Städte – und die ganze Welt.
Text: Alexander Görlach | Illustrationen: Marta Kochanek
Demokratie und Freiheit
Der neue Präsident ist
kein Betriebsunfall
Die Constitution, die Verfassung der USA, bevorzugt ländliche und dünner besiedelte Bundesstaaten. Das hat Auswirkungen auf die liberalen Städte – und die ganze Welt.
Text: Alexander Görlach | Illustrationen: Marta Kochanek
Über die Gründe für den Aufstieg von Donald Trump ist seit dem Jahr 2016 vieles gemutmaßt worden. Eine gängige Lesart besagt, Trump habe sich quasi der Republikanischen Partei bemächtigt und sie derart umgestaltet, dass er mit ihr die US-Demokratie von innen aushöhlen konnte. So gelang es dem TV-Entertainer, im Jahr 2016 die Wahl für sich zu entscheiden, obwohl Hillary Clinton mehr Stimmen auf sich vereinen konnte als er, und während der Amtszeit von Joe Biden zu behaupten, er habe in Wahrheit die Wahl im Jahr 2020 gewonnen.
Doch dieser Blickwinkel erzählt nur die halbe Geschichte. Denn es war kein Fehler im System, kein Unfall, dass die Republikaner damals mit dem Populisten Donald Trump ins Weiße Haus einziehen konnten, obwohl sie keine Mehrheit der Stimmen auf sich vereinten. Diese Möglichkeit ist vielmehr gewollt: Die US-Verfassung, die neben vielem anderen auch die Wahlen regelt, ist so gestrickt, dass sie die ländlichen Bundesstaaten bevorzugt – mit weitreichenden Konsequenzen.
Die USA sehen sich als Mutterland der modernen Demokratie. In dieses Narrativ eng hineinverwoben ist die Verfassung des Landes, die Constitution, die mit der Unabhängigkeitserklärung und der Bill of Rights das Gründungsdokument der Vereinigten Staaten darstellt. Amerikas Beispiel hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer Renaissance des Verfassungsgedankens beigetragen. Die Softpower der USA, das Hollywood-Kino vor allem, hat die Rede über die Verfassung, ihre Zusatzartikel zur freien Rede, zum Waffenbesitz und der Befreiung von Aussagen vor Gericht, die einen selbst belasten könnten, in die fernsten Winkel der Erde getragen. Der Glaube an dieses Dokument trägt quasi religiöse Züge.
Allerdings ist die Verfassung alles andere als perfekt, sondern sogar der Grund für die Situation, in der sich die USA befinden: Donald Trump hat sich dieses Umstands bloß geschickt bedient.
Der Harvard-Politologe Daniel Ziblatt macht diese Unvollkommenheit dafür verantwortlich, dass die über Jahrhunderte gewachsene Verfassung die älteste Demokratie der Welt heute lähmt. Denn was wie ein perfektes Schriftstück erscheinen soll, war schon von Beginn an ein einziger Kompromiss. Die Südstaaten des sich formierenden Landes hatten für den Beitritt zur neuen Union zur Bedingung gemacht, dass sie nicht von den bevölkerungsstarken nördlichen Bundesstaaten dominiert werden konnten, erläutert Ziblatt in seinem neuen Buch „Die Tyrannei der Minderheit“. Nach dem Ende des Bürgerkriegs und der Abschaffung der Sklaverei im Süden hätte eine rechtliche Gleichstellung der in die Freiheit entlassenen Menschen außerdem bedeutet, dass ihre Stimmen wahlentscheidend geworden wären. Im Süden konnte man sich damit nicht abfinden.
Eine Person, eine Wahlstimme, dieser demokratische Kernsatz galt schon zu Beginn des US-amerikanischen Projekts nicht. Jeder Bundesstaat sollte hingegen „Wahlmänner“ erhalten, deren Zahl sich nach seiner Größe richtete und nicht nach der Bevölkerungszahl. Wer das System der Wahlmänner ändern will, der muss die US-Verfassung ändern. Und das ist, weiß Ziblatt, alles andere als leicht: Beide Kammern des Senats müssen mit Zweidrittelmehrheit zustimmen, die gesetzgebenden Parlamente der Bundesstaaten mit Dreiviertelmehrheit. Ein solches Quorum wird nur selten erreicht: Seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1789 wurde die US-Verfassung nur 27-mal ergänzt, das deutsche Grundgesetz hingegen wurde 54-mal seit 1949 verändert.
Seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1789 wurde die US-Verfassung nur 27-mal ergänzt.
Eine gleichfalls wichtige Rolle nimmt das Verfassungsgericht der USA ein, der Supreme Court. Wer die Gesetzgebung kontrollieren und in seinem politischen Sinne ausgelegt sehen will, dem helfen Ernennungen von Obersten Richtern und Richterinnen der eigenen Partei. Donald Trump ist nicht der einzige Populist und Rechtsextreme, der sich an die Verfassung macht, um die demokratische Grundordnung seines Landes aus den Angeln zu heben. Beispiele gibt es zur Genüge: Polen, Ungarn, Italien, Indien und Israel. In den USA haben die Richter und Richterinnen am Supreme Court keine Altersbegrenzung, wer erst einmal ernannt ist, der kann bis zum Tod bleiben.
Donald Trump hat es geschafft, eine Mehrheit des Gerichts mit Angehörigen seiner rechten und illiberalen Auffassung zu besetzen. Dass diese Richter sich nicht im Einklang mit der Moralauffassung einer deutlichen Mehrheit der US-Bevölkerung befinden, zeigt ihre umstrittene Entscheidung zur Abtreibung: Darin gaben sie den Bundesstaaten das Recht, selbst eine Regelung aufzustellen. Nunmehr ist Abtreibung in 13 Bundesstaaten ohne Ausnahme illegal. Vier Bundesstaaten erlauben Abtreibungen nur in den ersten sechs Wochen der Schwangerschaft, also in einem Moment, an dem viele Frauen noch nicht wissen, dass sie schwanger sind. Nur zehn erlauben eine Abtreibung nach Vergewaltigung, neun im Falle von Inzest. Umfragen unter den Amerikanerinnen und Amerikanern ergeben jedoch solide Mehrheiten für eine Ausnahme nach Vergewaltigung, Inzucht oder für den Fall, dass das Leben der Mutter auf dem Spiel steht (was 41 der 50 Bundesstaaten vorsehen), sowie für eine generelle Erlaubnis der Abtreibung zwischen 12. und 15. Woche. Die Richter haben also die Agenda des rechten, ultrareligiösen Spektrums der Republikaner verwirklicht und nicht dem entsprochen, was die Moralvorstellung der Mehrheit der Amerikaner ist.
Die Verfassung gibt den ländlichen, dünn besiedelten Gebieten, in denen die Republikaner die Mehrheit stellen, einen Vorzug vor den Städten. Und das, obwohl rund 180 Millionen der 330 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner in Städten leben, meist an den Küstenstreifen, aber auch im Landesinneren. Die texanische Metropole Austin ist genauso liberal wie New York.
In der Vergangenheit hatten die Vereinigten Staaten immer die Kraft, aus sich heraus Veränderungen anzustoßen, Fehler zu korrigieren und einen völlig neuen Weg zu beschreiten. Das war allerdings zu Zeiten, in denen nicht zwei Drittel der Wähler und Wählerinnen der Republikaner glaubten, die letzte Wahl sei ihrem Kandidaten „gestohlen“ worden. Ob sich die Risse im Land, die durch acht Jahre Dauerbeschallung von Donald Trump und seinen Akolythen entstanden sind, überhaupt noch kitten lassen, wird sich in den Wochen bis zur Vereidigung am 20. Januar zeigen.

Alexander Görlach unterrichtet Demokratie-Theorie an der New York University. Unter anderem erschien von ihm: „Homo Empathicus: Von Sündenböcken, Populisten und der Rettung der Demokratie“ (Herder, 2019).

Alexander Görlach unterrichtet Demokratie-Theorie an der New York University. Unter anderem erschien von ihm: „Homo Empathicus: Von Sündenböcken, Populisten und der Rettung der Demokratie“ (Herder, 2019).
Auch interessant

Martin Biesel // Dreimal Rot für Amerika
Die Wahlergebnisse in den USA haben massive Auswirkungen auf das Land und die ganze Welt. In seiner zweiten Amtszeit ist Donald Trump ein machtvollerer Präsident als in der ersten. Wie er die Machtfülle nutzt, ist – wie Trump selbst – unberechenbar.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger // Die Kraft der Demokraten für ein liberales Land
Wir stehen vor richtungsweisenden Entscheidungen: Gegen die rechtspopulistische Verführung mit ihren simplen Vereinfachungen und ihrer Gewalt gegen Minderheiten müssen wir Demokraten zusammenarbeiten.

Axel Novak // Wählerwille im Wandel: Wird der Westen dem Osten folgen?
35 Jahre nach dem Fall der Mauer verliert die Parteiendemokratie in Ostdeutschland an Zustimmung. Angesichts vieler Krisen machen sich Enttäuschungen, Entfremdung und Skepsis breit. Der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität zu Berlin hat das Verhältnis zwischen Ost und West näher untersucht.