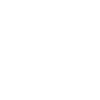
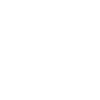
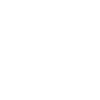
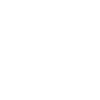
Olympia 2040
Deutschland,
trainier für Olympia!
Plädoyer für den Mut zu einem befreienden Ereignis
Text: Wolfram Eilenberger
Bronze! Als Teenager erblindet, stieß der Rendsburger Judoka Lennart Sass 2022 aus dem Nichts in die Weltspitze empor.

Bronze! Als Teenager erblindet, stieß der Rendsburger Judoka Lennart Sass 2022 aus dem Nichts in die Weltspitze empor.
Olympia 2040
Deutschland,
trainier für Olympia!
Plädoyer für den Mut zu einem befreienden Ereignis
Text: Wolfram Eilenberger
Lennart Sass, zum Beispiel: Bei seiner ersten Olympiateilnahme gewann der 24 Jahre alte Judoka diesen Sommer die Bronzemedaille. Nur Stunden zuvor hatte er als klarer Titelfavorit hoch überlegen das Halbfinale bestritten – und war aufgrund einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung disqualifiziert worden. Dennoch trat Sass voll fokussiert zum „kleinen Finale“ an. Es war einer jener Momente, die nicht eigens narrativ aufgeblasen werden müssen, um die mitreißende Kraft olympischen Strebens zu bezeugen.
Neben solchen Augenblicken selbstbestimmten Gelingens vermittelten die Wochen von Paris eindrucksvoll, was die Austragung Olympischer Spiele für eine Stadt und ein Land bedeuten kann. Paris wurde diesen Sommer zu einem weltweit bestaunten und gewürdigten Ort der Freude, der Schönheit sowie höchster menschlicher Aspirationen. Es brach damit einen langen Zirkel des Zynismus. An sich beste Voraussetzungen, dieses Momentum für eine deutsche Olympiabewerbung 2040 aufzunehmen, die die Bundesregierung und der Deutsche Sportbund nun in Angriff nehmen wollen.
Doch wird man den dazu nötigen Enthusiasmus hierzulande wirklich entfachen können? Die nötige Einigkeit stiften? Mannigfache föderale Blockaden überwinden? Das Zaudern voriger Anläufe lässt es abermals bezweifeln. Unter den gegebenen Bedingungen wird das Projekt „Olympia 2040“ zum großen Schlüsseltest für die quälend offene Frage, ob dieses Land überhaupt noch einen Sinn dafür hat, Großes umzusetzen.
Freier Wettkampf, freies Denken
Womöglich hilft es da, sich fern von platten Höher-schneller-weiter-Superlativen der eigentlich inspirierenden Botschaften Olympias zu vergewissern. Neben gelebter Friedfertigkeit sind diese vor allem Erfahrungen der Freiheit und Befreiung. Sofern moderner Sport als regelgeleitete Selbstüberwindung im Angesicht des anderen begriffen werden kann, sind Olympische Spiele Feste des grundmenschlichen Drangs nach dem Ausloten und Überwinden leiblicher Grenzen. Ein Individuum strebt im freien Wettkampf mit anderen danach, für sich und alle Welt den Raum des Menschenmöglichen zu erweitern: Die durch und durch emanzipatorische und damit liberale Note dieses Strebens tritt nicht nur in dem enormen Bedeutungszuwachs zutage, den der Frauensport in den letzten Jahrzehnten erfahren hat. Mehr und mehr verkörpern gerade die paralympischen Wettbewerbe diese Botschaft. Sie geht in Wahrheit weit über das Ziel der Inklusion hinaus. Anstatt nämlich das immer schon totalitäre Phantasma von der einen, einzigen und einheitlichen Gestalt eines wahren Hochleistungskörpers zu nähren, führen die Paralympics die eminent schöne Vielfalt menschlichen Strebens nach Selbstübertreffung mitreißend vor Augen.
Dieser olympische Zug zur Vielfalt leiblichen Erfahrens ist auch insofern unbedingt zu begrüßen, als die Sphären des Leistungssports sich in Deutschland mehr und mehr auf wenige populäre Formen zu verengen drohen. Insbesondere in Gestalt von Medienkönig Fußball, dessen an sich begrüßenswerte und ungebrochene Attraktivität für andere Sportarten kaum noch Luft zum Gedeihen lässt. Sport indes gibt es als Erfahrungsfeld nur im Plural. Nur als alltäglich kultivierter Pluralismus wirkt er in der Breite so befreiend und demokratiestärkend, wie von politischer Seite wieder und wieder behauptet wird. Es gibt kein wirkmächtigeres Schaufenster für diese Einsicht als Olympische Spiele.
Olympia 2040 wird zum Test, ob dieses Land noch einen Sinn dafür hat, Großes umzusetzen.
Auch für einen weiteren liberalen Kernwert kann die olympische Botschaft ihre Vorbildfunktion zurückgewinnen. Anstatt nämlich Gerechtigkeit auf Gleichheit zu reduzieren, verkörpern Olympioniken das Bekenntnis zu leistungsgerechter Differenz unter dem Zeichen der Fairness. Mögen nationale oder religiöse Animositäten auch noch so ausgeprägt sein, als Sportler begegnet uns der andere immer nur als Gegner und Ansporn, niemals als Feind und verwunschenes Hindernis. Gewiss, auch im sportlichen Wettkampf spielen Glück und Zufall bisweilen ergebnisentscheidende Rollen. Dennoch bleibt dort die Klammer zwischen Leistung und Erfolg wegweisend eng. Ein ausgemachter Stümper wird das olympische Treppchen niemals besteigen, ganz egal, welchen Namen er oder sie trägt, welcher Herkunft er ist oder welche Erbschaft sie im Rücken weiß. Nicht einmal sogenanntes Talent als natürliches Geburtsgeschenk reicht hier hin. Ohne den täglichen Willen, besser zu werden in dem, was man aus Leidenschaft und freier Entscheidung tut, bleibt der Weg zu letzter Anerkennung verbaut.
Mit anderen Worten: Die in modernen Marktgesellschaften sich gängig zum Abgrund weitende Spaltung zwischen faktischer Leistung und erfahrenem Erfolg existiert in Olympias Welt so nicht. Und das ist unbedingt gut so. Ja, geradezu wegweisend. Gerade in einem Land wie dem unseren, dessen wettbewerbsaverse Selbstzermürbungstendenzen im Jahre 2024 den ungeschminkten Blick in den Medaillenspiegel zum traurigen Schauderereignis werden ließen. Was also könnte dieser Republik Besseres widerfahren als ein Aufbruch zur jener gefeierten Freiheit, genossenen Vielfalt und gelebten Leistungsfairness, die im Verlauf der Pariser Spiele geradezu körperlich zu spüren waren?

Fünf Ringe: München war schon 1972 Austragungsort der Olympischen Spiele und ist auch für 2040 noch im Rennen. Dabei könnte die unverbrauchte Rhein-Ruhr-Region der bessere Kandidat sein.
Die Spaltung zwischen faktischer Leistung und erfahrenem Erfolg existiert bei Olympia so nicht.
Renaissance an Rhein und Ruhr
Bleibt im Falle Deutschlands die nicht zuletzt aus historischen Gründen kritische Frage des zu bewerbenden Ortes. Neben Berlin und München, beide bereits einmal Ausrichterstädte, steht mit der Rhein-Ruhr-Region um Düsseldorf und Essen für 2040 ein weiterer ausgezeichneter Kandidat bereit. Tatsächlich lässt sich kaum eine Region Deutschlands oder gar Europas vorstellen, die eher geeignet wäre, den guten Geistern Olympias neue Heimstatt zu bieten. Nach Jahrzehnten gefühlten Absteigens und schmerzhafter Strukturtransformationen verdiente es das Ruhrgebiet, als Ort möglicher Selbsterneuerung wahrgenommen, gefeiert und weiter unterstützt zu werden: ökologisch als Ort gelingender Renaturierung, ökonomisch als postindustrielle Bildungsregion, kulturell als integrationsstarker Hub im Zentrum des Kontinents. Auf der Suche nach einer neuen, zukunftsfähigen Identität der einstigen Bergbauregion möge der Aufbruch zum Olymp des Sports wahre Wunder wirken. Und auch mit Blick auf das dort noch immer misslich vorherrschende Denken in Klein- und Kleinstrevieren den entscheidenden Sprung nach vorn bedeuten.
An sportlicher Begeisterungsfähigkeit herrschte in diesem Ballungsraum gewiss kein Mangel, genauso wenig wie an Stadien und weiteren Stätten gelebter Solidarität.
as Rhein- und Ruhrgebiet als beispielhafter Gelingensort eines zukunftsfähigen Deutschlands – jenseits von falscher Nostalgie und industriell betriebener Naturverheerung. Eigentlich wäre alles da! Fehlten nur noch der politische Wille sowie der geteilte Glaube, die es braucht, um olympische Gipfel aus eigener Kraft zu erklimmen. Gegen alle Skeptiker, Zyniker – und a priori Resignierten.
ine Bewerbung im Geiste von Lennart Sass also. Als 16-Jähriger erblindete er aufgrund einer Erbkrankheit binnen weniger Wochen. Dennoch hörte der Judoka nicht auf, seinem olympischen Traum zu folgen. Wer weiß, wohin er ihn noch leiten mag? Zum Beispiel ins Jahr 2040 – als Fahnenträger von Team Deutschland bei den Spielen im eigenen Land. Schön wäre es.

Wolfram Eilenberger ist Philosoph und Autor. Zuletzt erschien von ihm „Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933–1943)“.

Wolfram Eilenberger ist Philosoph und Autor. Zuletzt erschien von ihm „Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933–1943)“.
Auch interessant

Philipp Hindahl // Palast der Zweifel
Das Humboldt-Forum Berlin steht dort, wo einst der berühmteste DDR-Kulturbau stand. Nun wirft eine Ausstellung zum Palast der Republik die Frage auf, welcher Vorstellung von Modernität wir uns verschreiben.

Karl-Heinz Paqué // Dieses Mal ist alles anders. Wirklich?
Timothy Garton Ash erzählt seine persönliche Geschichte Europas

Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff // Wir Kurzsichtigen
In der Geschichte der Finanzkrisen kann man immer wieder feststellen
