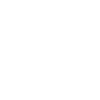
Erinnerungskultur
Palast der Zweifel
Das Humboldt-Forum Berlin steht dort, wo einst der berühmteste DDR-Kulturbau stand. Nun wirft eine Ausstellung zum Palast der Republik die Frage auf, welcher Vorstellung von Modernität wir uns verschreiben.
Text: Philipp Hindahl

Erinnerungskultur
Palast der Zweifel
Das Humboldt-Forum Berlin steht dort, wo einst der berühmteste DDR-Kulturbau stand. Nun wirft eine Ausstellung zum Palast der Republik die Frage auf, welcher Vorstellung von Modernität wir uns verschreiben.
Text: Philipp Hindahl
Der Palast der Republik ist lange weg. Der Repräsentationsbau der DDR existiert nur als Erinnerung, dabei beanspruchte er einst einen Platz in der Mitte Berlins. An seine Stelle ist das Humboldt-Forum getreten, das in einem Nachbau des preußischen Stadtschlosses Platz gefunden hat – und damit wird es schon kompliziert, architektonisch und politisch. Als Nachfolgeinstitution und Gegenmodell des Palastes zeigt es nun eine Ausstellung über den Prestigebau Ostberlins. Bei der Schau „Hin und Weg“ sollen die Besucherinnen und Besucher mitmachen und, ja, sich auch erinnern.
Erinnerung ist nicht das Gleiche wie Geschichte. Wie nach innen verspiegelt ist der erste Raum der Ausstellung mit Bronzepappen verhängt, die aussehen wie die bronzene Glasfassade des DDR-Palasts. Mit weißen Stiften können die Besucherinnen und Besucher ihre Assoziationen aufschreiben.
Der Palast der Republik, der seit seiner Eröffnung im April 1976 das Marx-Engels-Forum der Hauptstadt der DDR bestimmte, brauchte fünf Jahre bis zur Fertigstellung. Er war der erste abgehängte Stahlskelettbau der DDR und bot zwei Sälen Platz: Im kleinen tagte die Volkskammer; im großen fanden Konzerte statt, aber auch Tanzveranstaltungen oder die Unterhaltungssendung „Ein Kessel Buntes“. Dreizehn Lokale beherbergte der Bau: Restaurants, Cafés, eine Disko, Bowlingbahnen und ein Theater, in dem Heiner Müller gespielt wurde. Der Eingangsbereich war prächtig. Die unzähligen verchromten Lampen unter der hohen Decke brachten dem Bau den Spitznamen „Erichs Lampenladen“ ein, das komplexe Gitter sah ein bisschen aus wie Modelle von Molekülen, und vielleicht sollte der Bau auch so etwas sein: das idealtypische mikroskopische Modell des sozialistischen Deutschlands.
Alles war farblich aufeinander abgestimmt. Von den Uniformen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis zum Geschirr war jedes Objekt mit dem geschwungenen PdR-Logo versehen, als wäre das die sozialistische Version einer allumfassenden Markenerfahrung, als hätte das Regime verstanden, dass die Menschen auch im Sozialismus Bedürfnisse haben, die über Arbeit und Propaganda hinausgehen: Konsum, Kultur und Konsum von Kultur. Draußen prangte an der Fassade das Wappen aus Hammer, Zirkel und Ährenkranz.
Abwicklung von Identität
Lange stand aber gar nicht fest, was das SED-Regime eigentlich in die Mitte seiner Hauptstadt bauen wollte. Ursprünglich war ein Regierungshochhaus geplant. Doch allmählich wurde klar, dass eher repräsentative und kulturelle Funktionen gefragt waren. Vorbilder waren die Kulturhäuser und Arbeiterklubs, die in den Sowjetrepubliken zu Palästen angewachsen waren.

Mit dem Schlossneubau war jeder Zweifel brachial ausgeräumt.
Im Westen hingegen eröffnete nur ein Jahr danach in Paris ein verwandter Bau, das Centre Pompidou, das schon einer Zeit nach der Moderne anzugehören schien. Doch die Frage, was für ein Moderneverständnis im Palast der Republik steckt, geht die aktuelle Ausstellung allenfalls implizit an. Der Architekt Wolf R. Eisentraut, Teil des Kollektivs um Heinz Graffunder, spricht darüber, dass der Bau modern sein sollte. Damit scheint aber eher seine seltsam üppige, marmorne Geradlinigkeit gemeint zu sein als ein Anknüpfen ans Bauhaus und seine Folgen. Renzo Pianos und Richard Rogers’ Bau in Paris hingegen verkörpert eher den Triumph der Postmoderne.
Und so wurde der Palast der Republik schnell nach dem Ende der DDR geschlossen. Die Asbestbelastung war ein Grund, die Kulturpolitik der 1990er-Jahre ein anderer. Der Abriss wurde beschlossen, viele protestierten, denn hier wurde auch ein Stück ostdeutscher Identität abgewickelt. Manche proklamierten ein Ende der Geschichte, denn die liberale Demokratie, so die optimistische Deutung der Ereignisse, hätte in einer gewaltlosen Revolution gewonnen.
Aber das bedeutet nicht das Ende der Erinnerung, denn die ist oft widersprüchlich, und hier schreiben sich Traumata ein. „Erinnerung ist persönlich, die Geschichte träumt von Objektivität; Erinnerung basiert nicht auf Wissen, sondern auf Erfahrung“, schrieb die russische Autorin Marija Stepanowa, die heute im Berliner Exil lebt. Eine zweijährige Zwischennutzung mit Konzerten und Ausstellungen gab es noch im entkernten Palast, 2006 kam der Abriss.
Die Ausstellung im Humboldt-Forum zeigt den Palast der Republik als ambivalentes Objekt: Symbol eines Unrechtsregimes, aber auch ein Palast für alle in wohliger Erinnerung.
Fast zwei Jahrzehnte nach dem Abriss steht nun das Humboldt-Forum da, das nicht weniger umstritten ist. Auch die Ausstellung „Hin und weg“ ist Ziel der Kritik: Die Konflikte des Ortes und des Schlossneubaus würden durch ein Kulturprogramm übertüncht.
Dagegen verspricht der Untertitel der Ausstellung: „Der Palast der Republik ist Gegenwart.“ Doch in der Gegenwart kommt sie nie an. „Erinnerungsarbeit bedeutet, Emotionen zuzulassen, Vertrauen aufzubauen, Verantwortung zu übernehmen“, heißt es im Katalog. Man kann der Ausstellung Nostalgie vorwerfen, vielleicht versucht sie auch eine kollektive Therapie; dabei unternimmt sie eine Gratwanderung zwischen Erinnerung und Geschichte.
„Zweifel“ stand in riesenhaften Leuchtbuchstaben während der Zwischennutzung über der bronzenen Fassade des alten DDR-Palasts, eine Arbeit des norwegischen Künstlers Lars Ø. Ramberg. Noch 2017 sollte der Schriftzug auch an der Schlossfassade wieder angebracht werden, weil methodischer Zweifel ein Kernelement der Aufklärung gewesen sei. Vier Jahre später, unter neuer Intendanz, eröffnete der Schlossneubau ohne den Schriftzug. Damit war jeder Zweifel brachial ausgeräumt.

Philipp Hindahl lebt in Berlin und schreibt über Kunst, Architektur, Bücher und Gesellschaft.

Philipp Hindahl lebt in Berlin und schreibt über Kunst, Architektur, Bücher und Gesellschaft.
Auch interessant

Wolfram Eilenberger // Deutschland, trainier für Olympia!
Plädoyer für den Mut zu einem befreienden Ereignis

Karl-Heinz Paqué // Dieses Mal ist alles anders. Wirklich?
Timothy Garton Ash erzählt seine persönliche Geschichte Europas

Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff // Wir Kurzsichtigen
In der Geschichte der Finanzkrisen kann man immer wieder feststellen
