Vor verschlossenen Türen
Aus den Sondierungsgesprächen in Berlin drang nur wenig nach draußen. Das ist gut so – und durchaus kein Versagen der Medien.
TEXT: MICHAEL HIRTZ
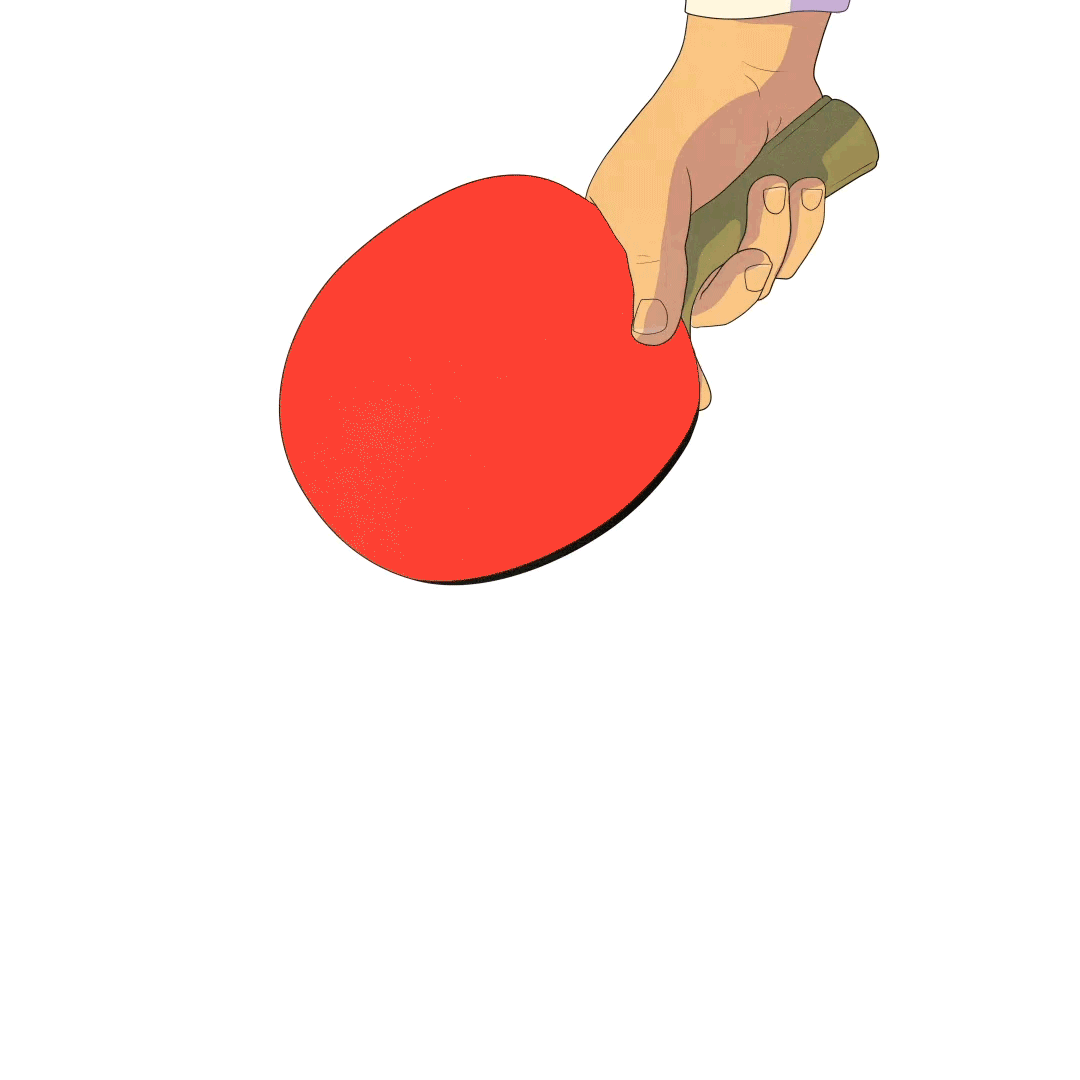
Deutschland nach der Wahl
Vor verschlossenen Türen
Aus den Sondierungsgesprächen in Berlin drang nur wenig nach draußen. Das ist gut so – und durchaus kein Versagen der Medien.
TEXT: MICHAEL HIRZ
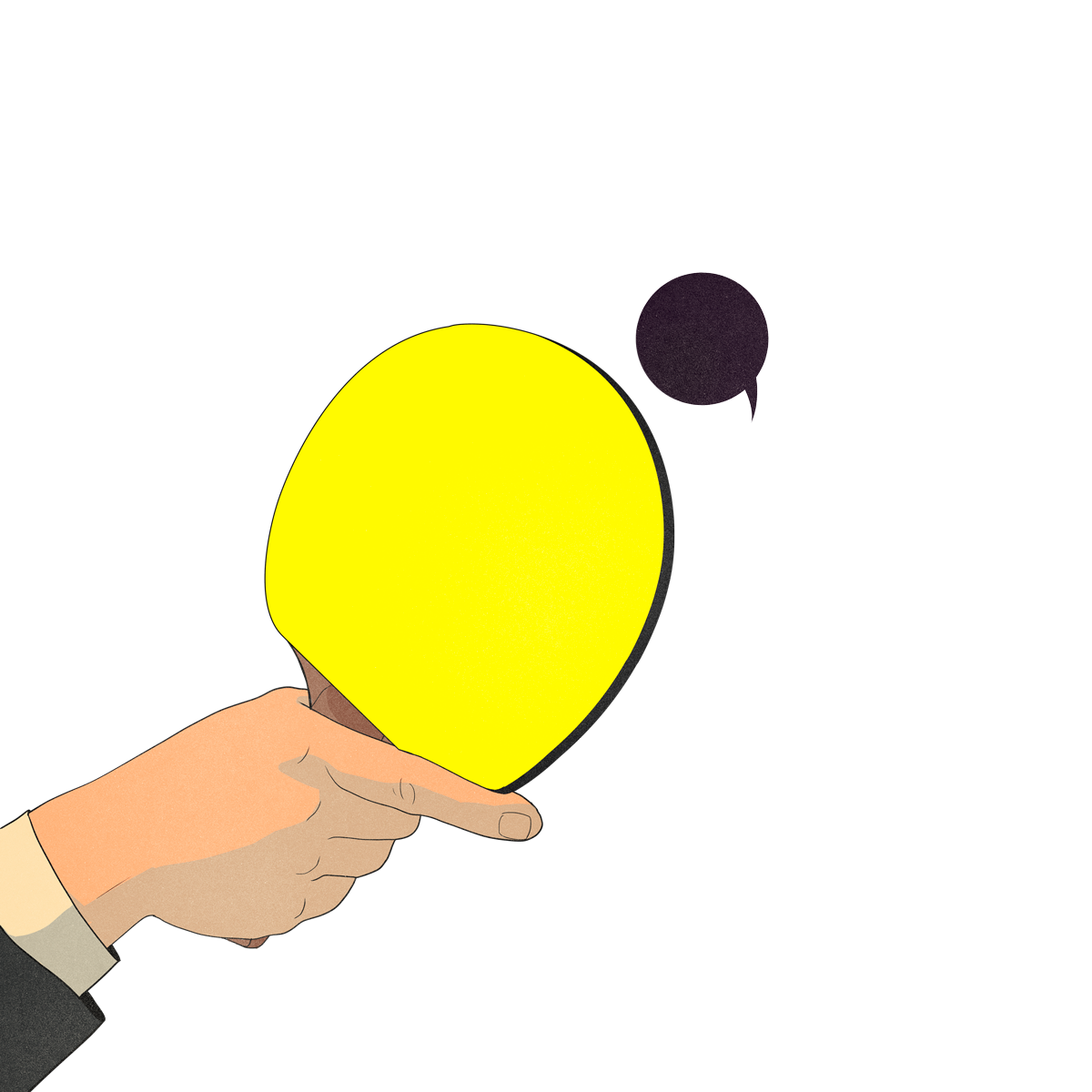
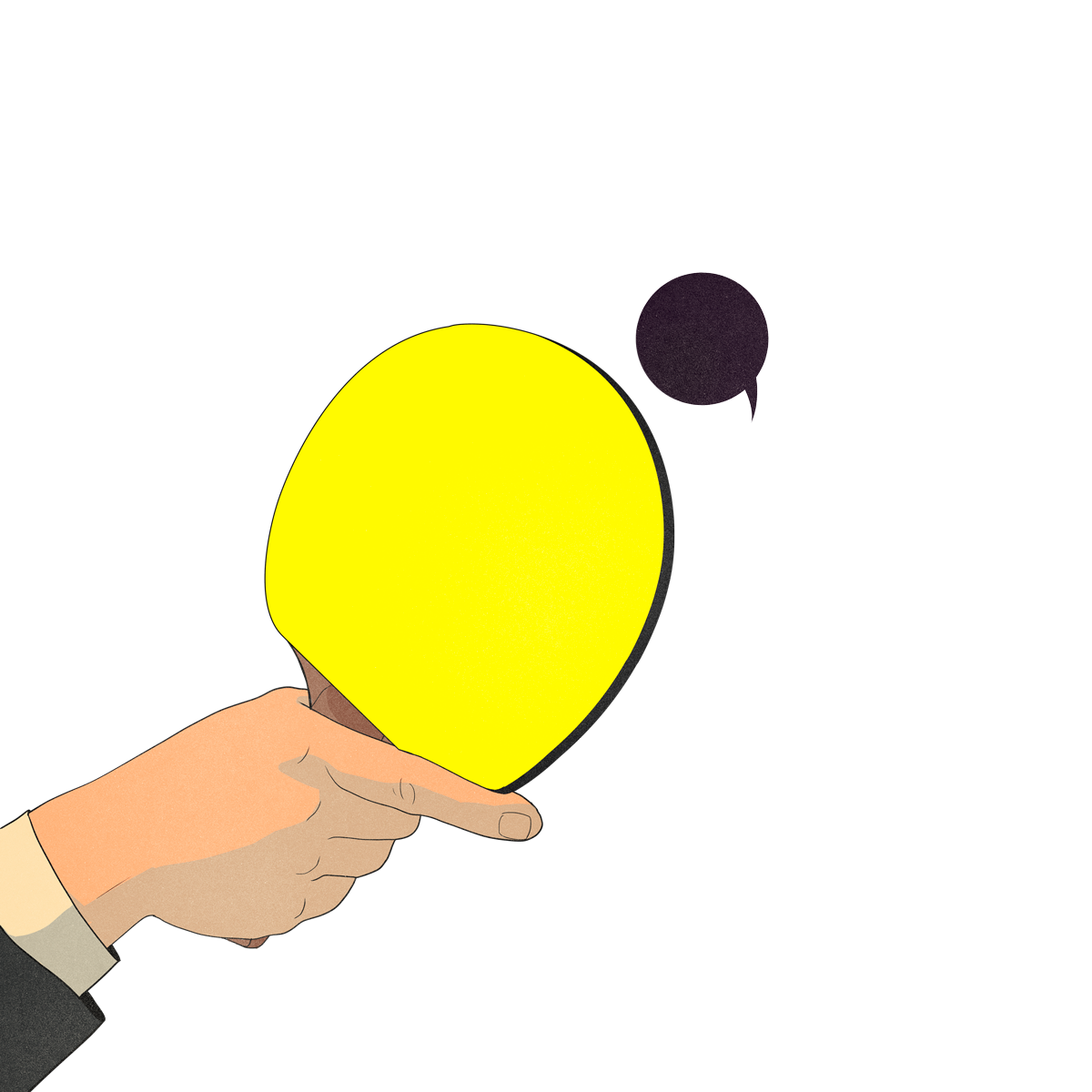
Der zurückliegende Wahlkampf war inhaltsleer und langweilig? Das wird vielfach behauptet, und man kann es so sehen. Dem Wahlergebnis, das sich diesen unerquicklichen Kampagnen dann am 26. September anschloss, verdankt die deutsche Sprache freilich immerhin eine Wortneuschöpfung: Sondierungsjournalismus. Denn während sich die Parteien nunmehr in einer kollektiven Suchbewegung damit abmühen, den Wählerwunsch zu interpretieren, leuchten die Scheinwerfer einer nervösen Mediengesellschaft die politische Bühne umso greller aus: Wer spricht wann mit wem, wer runzelt wann die Stirn, wer twittert was?
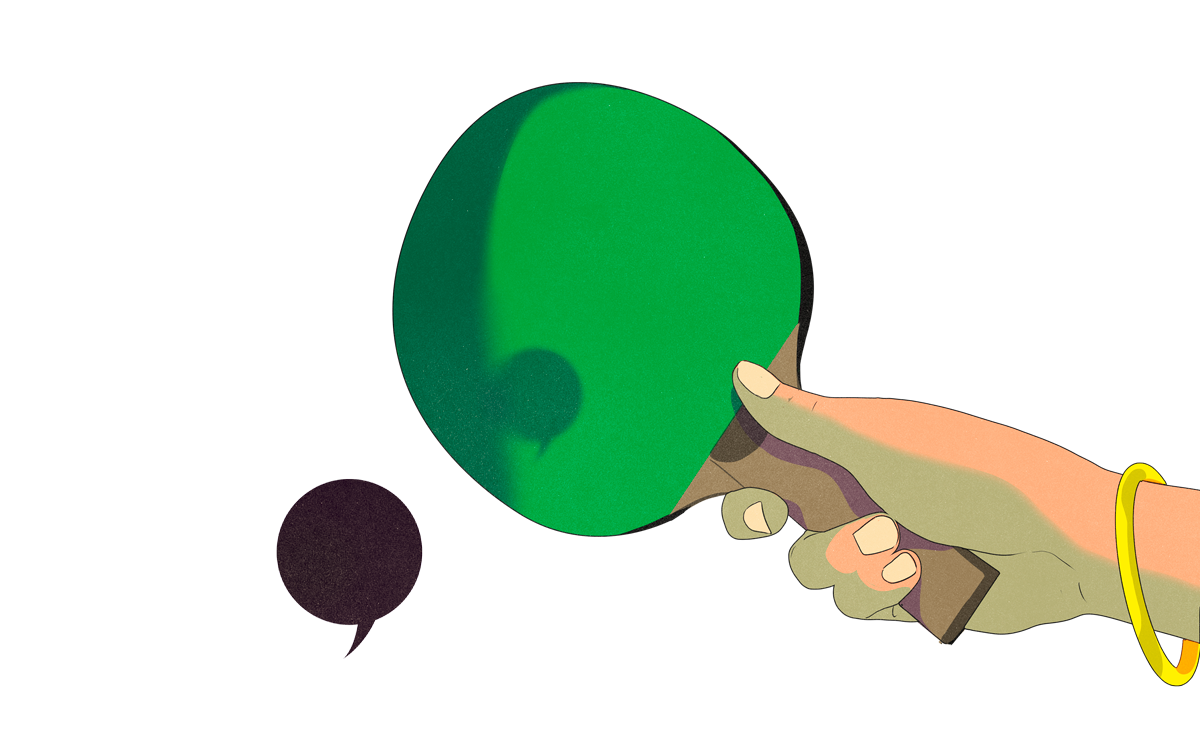
Doch was bringt das? Wie substanziell kann das Ergebnis des Sondierungsjournalismus sein? Wissen wir wirklich mehr, wenn Reporterinnen und Reporter vor den verschlossenen Türen stehen und in der Regel nur Vermutungen abliefern, als wären sie Orakel – und nicht Journalisten? Die offene Ehrlichkeit eines Sokrates („Ich weiß, dass ich nichts weiß“) wird allerdings vom Arbeitgeber nicht honoriert und vom zahlenden Publikum auch nicht.
Natürlich gibt es eine verständliche und völlig legitime Neugier im Wahlvolk, wer ins Kanzleramt einziehen wird und auf welche Kräfte er oder sie sich dabei stützt. Schließlich geht es um nichts Geringeres als die Zukunft des Landes. Und natürlich gehört es zu den ebenso völlig legitimen Aufgaben des Journalismus, diese Neugier zu befriedigen. Schließlich ist Transparenz die Grundvoraussetzung für eine freie, offene Gesellschaft. Das abgedunkelte Hinterzimmer darf nicht der Ort für demokratische Entscheidungen sein.
Vertrauen braucht Schutz
Doch die Demokratie nimmt keinen Schaden, wenn Medien mit ihren Bemühungen scheitern, Details aus den Sondierungsgesprächen der Parteien zu erfahren. Gerade nach den Zuspitzungen eines Wahlkampfs geht es nunmehr erst einmal darum, Perspektiven und Grenzen einer möglichen Zusammenarbeit auszuloten. Das braucht Vertrauen und geschützte Räume, in denen die Gesprächsteilnehmer offen nach Lösungen suchen können, um programmatische oder auch persönliche Unverträglichkeiten auszuräumen. Wenn zu jedem Zeitpunkt dieses schwierigen Prozesses Kameras und Mikrofone mit von der Partie wären, ließen sich die notwendigen Kompromisse, mit denen immer das schmerzhafte Aufgeben herkömmlicher Positionen einhergeht, ungleich schwieriger erzielen.
Egoistische Ziele
Wenn einzelne Politikerinnen und Politiker aus den Sondierungsgesprächen heraus Tweets absetzen, dann ist das kein demokratiefördernder Beitrag zur Transparenz. Der Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit dient vielmehr nichts anderem als den eigenen Zielen. Dass Medien wie die „Bild“ das aufgreifen und veröffentlichen, ist selbstverständlich. Es ist ihr Job. Solche Tweets stellen dann sogar eine echte, relevante Nachricht dar. Denn sie geben einen wichtigen Hinweis auf Charakter und Verlässlichkeit. Und damit wäre wieder der Transparenz gedient – was will man mehr?
Der zurückliegende Wahlkampf war inhaltsleer und langweilig? Das wird vielfach behauptet, und man kann es so sehen. Dem Wahlergebnis, das sich diesen unerquicklichen Kampagnen dann am 26. September anschloss, verdankt die deutsche Sprache freilich immerhin eine Wortneuschöpfung: Sondierungsjournalismus. Denn während sich die Parteien nunmehr in einer kollektiven Suchbewegung damit abmühen, den Wählerwunsch zu interpretieren, leuchten die Scheinwerfer einer nervösen Mediengesellschaft die politische Bühne umso greller aus: Wer spricht wann mit wem, wer runzelt wann die Stirn, wer twittert was?
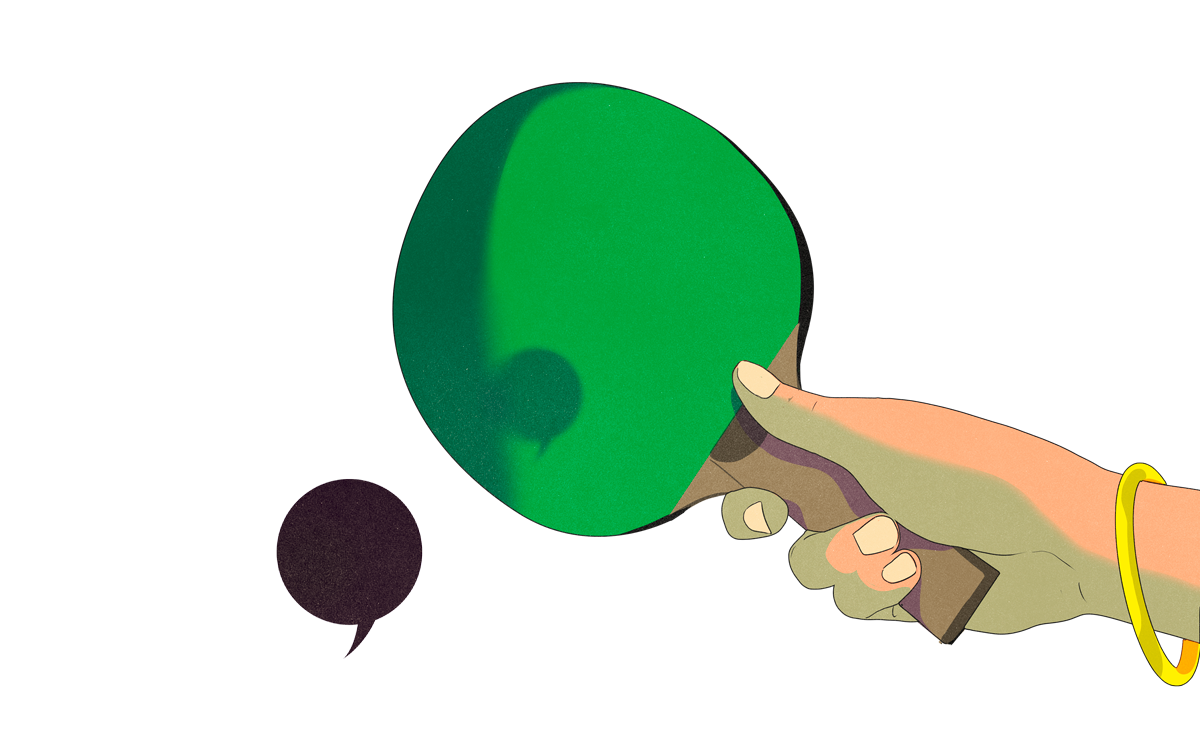
Doch was bringt das? Wie substanziell kann das Ergebnis des Sondierungsjournalismus sein? Wissen wir wirklich mehr, wenn Reporterinnen und Reporter vor den verschlossenen Türen stehen und in der Regel nur Vermutungen abliefern, als wären sie Orakel – und nicht Journalisten? Die offene Ehrlichkeit eines Sokrates („Ich weiß, dass ich nichts weiß“) wird allerdings vom Arbeitgeber nicht honoriert und vom zahlenden Publikum auch nicht.
Natürlich gibt es eine verständliche und völlig legitime Neugier im Wahlvolk, wer ins Kanzleramt einziehen wird und auf welche Kräfte er oder sie sich dabei stützt. Schließlich geht es um nichts Geringeres als die Zukunft des Landes. Und natürlich gehört es zu den ebenso völlig legitimen Aufgaben des Journalismus, diese Neugier zu befriedigen. Schließlich ist Transparenz die Grundvoraussetzung für eine freie, offene Gesellschaft. Das abgedunkelte Hinterzimmer darf nicht der Ort für demokratische Entscheidungen sein.
Vertrauen braucht Schutz
Doch die Demokratie nimmt keinen Schaden, wenn Medien mit ihren Bemühungen scheitern, Details aus den Sondierungsgesprächen der Parteien zu erfahren. Gerade nach den Zuspitzungen eines Wahlkampfs geht es nunmehr erst einmal darum, Perspektiven und Grenzen einer möglichen Zusammenarbeit auszuloten. Das braucht Vertrauen und geschützte Räume, in denen die Gesprächsteilnehmer offen nach Lösungen suchen können, um programmatische oder auch persönliche Unverträglichkeiten auszuräumen. Wenn zu jedem Zeitpunkt dieses schwierigen Prozesses Kameras und Mikrofone mit von der Partie wären, ließen sich die notwendigen Kompromisse, mit denen immer das schmerzhafte Aufgeben herkömmlicher Positionen einhergeht, ungleich schwieriger erzielen.
Egoistische Ziele
Wenn einzelne Politikerinnen und Politiker aus den Sondierungsgesprächen heraus Tweets absetzen, dann ist das kein demokratiefördernder Beitrag zur Transparenz. Der Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit dient vielmehr nichts anderem als den eigenen Zielen. Dass Medien wie die „Bild“ das aufgreifen und veröffentlichen, ist selbstverständlich. Es ist ihr Job. Solche Tweets stellen dann sogar eine echte, relevante Nachricht dar. Denn sie geben einen wichtigen Hinweis auf Charakter und Verlässlichkeit. Und damit wäre wieder der Transparenz gedient – was will man mehr?
Der zurückliegende Wahlkampf war inhaltsleer und langweilig? Das wird vielfach behauptet, und man kann es so sehen. Dem Wahlergebnis, das sich diesen unerquicklichen Kampagnen dann am 26. September anschloss, verdankt die deutsche Sprache freilich immerhin eine Wortneuschöpfung: Sondierungsjournalismus. Denn während sich die Parteien nunmehr in einer kollektiven Suchbewegung damit abmühen, den Wählerwunsch zu interpretieren, leuchten die Scheinwerfer einer nervösen Mediengesellschaft die politische Bühne umso greller aus: Wer spricht wann mit wem, wer runzelt wann die Stirn, wer twittert was?
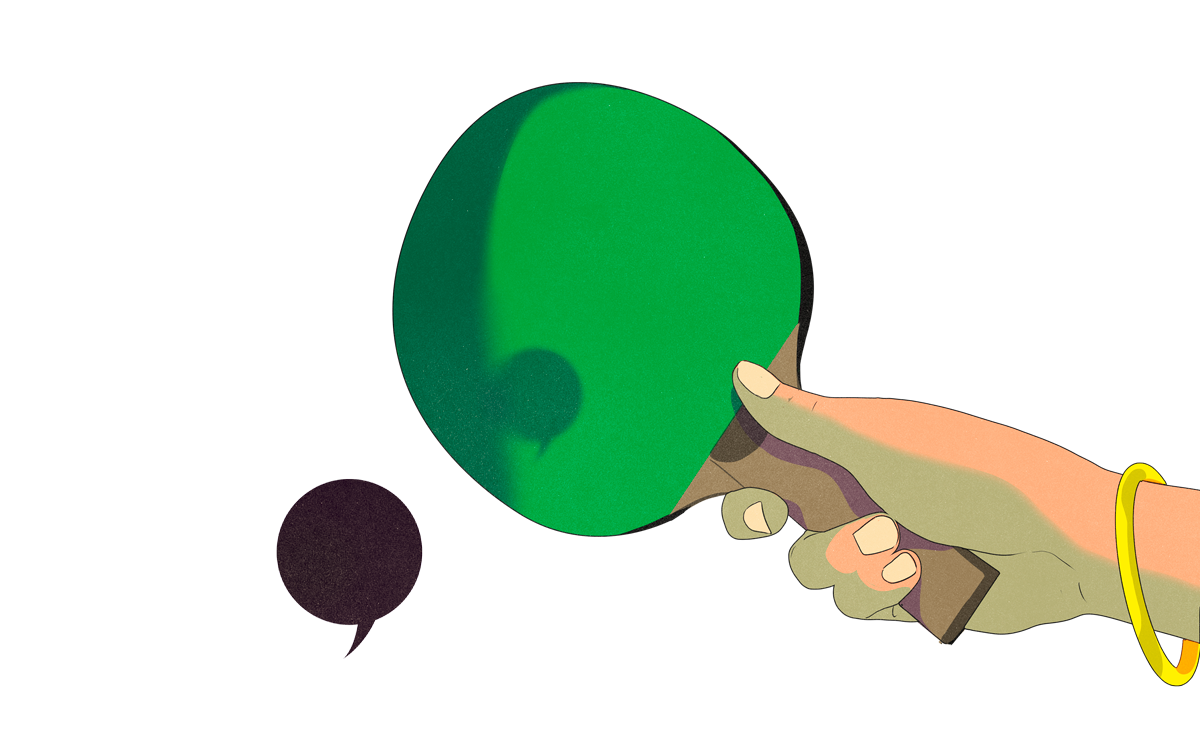
Doch was bringt das? Wie substanziell kann das Ergebnis des Sondierungsjournalismus sein? Wissen wir wirklich mehr, wenn Reporterinnen und Reporter vor den verschlossenen Türen stehen und in der Regel nur Vermutungen abliefern, als wären sie Orakel – und nicht Journalisten? Die offene Ehrlichkeit eines Sokrates („Ich weiß, dass ich nichts weiß“) wird allerdings vom Arbeitgeber nicht honoriert und vom zahlenden Publikum auch nicht.
Natürlich gibt es eine verständliche und völlig legitime Neugier im Wahlvolk, wer ins Kanzleramt einziehen wird und auf welche Kräfte er oder sie sich dabei stützt. Schließlich geht es um nichts Geringeres als die Zukunft des Landes. Und natürlich gehört es zu den ebenso völlig legitimen Aufgaben des Journalismus, diese Neugier zu befriedigen. Schließlich ist Transparenz die Grundvoraussetzung für eine freie, offene Gesellschaft. Das abgedunkelte Hinterzimmer darf nicht der Ort für demokratische Entscheidungen sein.
Vertrauen braucht Schutz
Doch die Demokratie nimmt keinen Schaden, wenn Medien mit ihren Bemühungen scheitern, Details aus den Sondierungsgesprächen der Parteien zu erfahren. Gerade nach den Zuspitzungen eines Wahlkampfs geht es nunmehr erst einmal darum, Perspektiven und Grenzen einer möglichen Zusammenarbeit auszuloten. Das braucht Vertrauen und geschützte Räume, in denen die Gesprächsteilnehmer offen nach Lösungen suchen können, um programmatische oder auch persönliche Unverträglichkeiten auszuräumen. Wenn zu jedem Zeitpunkt dieses schwierigen Prozesses Kameras und Mikrofone mit von der Partie wären, ließen sich die notwendigen Kompromisse, mit denen immer das schmerzhafte Aufgeben herkömmlicher Positionen einhergeht, ungleich schwieriger erzielen.
Egoistische Ziele
Wenn einzelne Politikerinnen und Politiker aus den Sondierungsgesprächen heraus Tweets absetzen, dann ist das kein demokratiefördernder Beitrag zur Transparenz. Der Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit dient vielmehr nichts anderem als den eigenen Zielen. Dass Medien wie die „Bild“ das aufgreifen und veröffentlichen, ist selbstverständlich. Es ist ihr Job. Solche Tweets stellen dann sogar eine echte, relevante Nachricht dar. Denn sie geben einen wichtigen Hinweis auf Charakter und Verlässlichkeit. Und damit wäre wieder der Transparenz gedient – was will man mehr?

Michael Hirtz ist Journalist und Moderator. Von 2008 bis 2018 leitete er den Politiksender Phoenix. Heute schreibt er als Autor für Zeitungen und Magazine und berät in Medienfragen.
