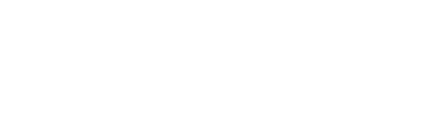Desinformation
Perfider Krieg
gegen Frauen
Die Boxerin Imane Khelif und die taiwanesische Abgeordnete Huang Jie werden im Netz angegriffen. Der Grund? Sie sind Frauen. Geschlechtsspezifische Desinformation ist mittlerweile ein weitverbreitetes Phänomen im Netz. Kampagnen gegen Frauen sollen diese delegitimieren und die demokratischen Gesellschaften spalten.
Text: Zoë van Doren
Imane Khelif (li.) und Huang Jie. Die Boxerin Khelif muss sich derzeit rechtfertigen, weil sie eine Frau ist.

Desinformation
Perfider Krieg
gegen Frauen
Die Boxerin Imane Khelif und die taiwanesische Abgeordnete Huang Jie werden im Netz angegriffen. Der Grund? Sie sind Frauen. Geschlechtsspezifische Desinformation ist mittlerweile ein weitverbreitetes Phänomen im Netz. Kampagnen gegen Frauen sollen diese delegitimieren und die demokratischen Gesellschaften spalten.
Text: Zoë van Doren
Imane Khelif (li.) und Huang Jie. Die Boxerin Khelif muss sich derzeit rechtfertigen, weil sie eine Frau ist.
Längst ist Desinformation als gesellschaftliches Problem erkannt. Phänomene wie Propa ganda, KI-generierte Falschinformationen und algorithmische Verstärkung werden mittlerweile breit diskutiert. Doch oft richtet sich Informationsmanipulation gegen Frauen und Minderheiten und wird so zur ernsthaften Bedrohung für demokratische Grundwerte. Sie nutzt gesellschaftliche Vorurteile und Stereotypen aus, um die Kompetenz, Moral und Legitimität der Betroffenen infrage zu stellen und ihre Stimmen aus dem öffentlichen Diskurs zu drängen.
Der Fall der algerischen Boxerin Imane Khelif veranschaulicht dieses Phänomen. Sie wurde von den Box-Weltmeisterschaften in Russland 2023 kurz vor dem Kampf um die Goldmedaille ausgeschlossen. Angeblich erfüllte sie unspezifizierte Zulassungskriterien nicht. Khelif hatte zuvor gegen die bis dahin ungeschlagene russische Boxerin Azalia Amineva gewonnen. Die öffentliche Kontroverse um ihren Ausschluss löste anschließend eine Welle gezielter Angriffe aus. Khelif wurde während der Olympischen Spiele 2024 Ziel massiver Desinformationen, die ihre Geschlechtsidentität bezweifelten. Diese Angriffe basierten auf tief verwurzelten Stereotypen über Frauen im Sport.
Die psychologischen Auswirkungen solcher Angriffe sind verheerend. Betroffene leiden häufig unter Angstzuständen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Viele ziehen sich aus dem öffentlichen Leben zurück.
Geschlechtsspezifische Desinformation wird zudem als geopolitisches Werkzeug eingesetzt. Staatliche und nicht- staatliche Akteure nutzen sie, um gesellschaftliche Spaltungen zu vertiefen. Ein prägnantes Beispiel hierfür ist der Fall der taiwanesischen Abgeordneten Huang Jie, die regelmäßig Ziel chinesischer Desinformationskampagnen wurde. Nach einem viral gegangenen Video, das sie beim Augenrollen während einer Rede eines politischen Gegners zeigte, orchestrierten chinesische staatsnahe Akteure gezielte Angriffe, die Huang als respektlos, unreif und für ein öffentliches Amt ungeeignet darstellten.
Die Kampagnen eskalierten mit manipulierten Bildern und Videos, die Huang in kompromittierenden Situationen zeigten, sowie mit falschen Korruptionsvorwürfen. Diese systematischen Angriffe zielten darauf ab, nicht nur Huangs persönliche Glaubwürdigkeit zu untergraben, sondern auch ihre prodemokratische Haltung zu diskreditieren und damit die taiwanesische Demokratie insgesamt zu schwächen – ein klassisches Beispiel für den Einsatz geschlechtsspezifischer Desinformation als Instrument hybrider Kriegsführung.
Geschlechtsspezifische Desinformation ist somit nicht nur ein individuelles Problem, sondern eine strukturelle Herausforderung für Demokratien. Wenn bestimmte Gruppen systematisch diskreditiert und aus dem öffentlichen Raum gedrängt werden, ist das gesellschaftliche Fundament der Demokratie bedroht.
Das Problem ist längst erkannt: Nach einer Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zur Mediennutzung und Anfälligkeit für Desinformation betrachten viele Menschen Falschinformationen als ein „großes Problem“. Allerdings fällt es vielen Menschen schwer, Desinformationen als solche zu erkennen.
Die Studie zur Mediennutzung und Anfälligkeit für Desinformation finden Sie HIER
Zoë van Doren ist Referentin für Globale Digitalisierung und Innovation in der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Dafür arbeitet sie eng mit dem Global Innovation Hub der Stiftung in Taiwans Hauptstadt Taipeh zusammen.
Zoë van Doren ist Referentin für Globale Digitalisierung und Innovation in der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Dafür arbeitet sie eng mit dem Global Innovation Hub der Stiftung in Taiwans Hauptstadt Taipeh zusammen.
Auch interessant
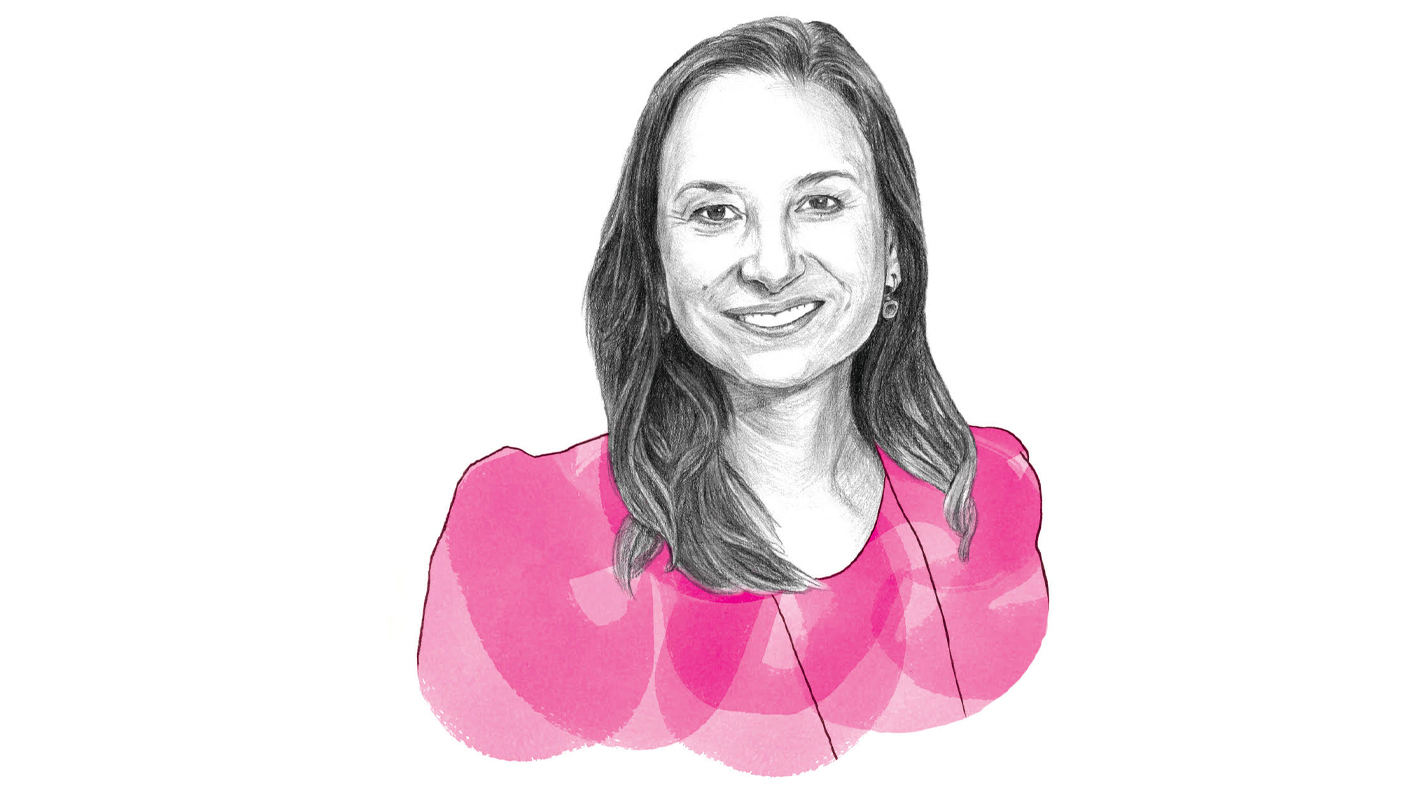
Maren Jasper-Winter // Mutterschutz nach Fehlgeburten
Der deutsche Staat hat in dem Dreivierteljahrhundert seit seiner Gründung viel von seiner Leistungsfähigkeit eingebüßt, Speck angesetzt, über seine Verhältnisse gelebt. Da stellt sich die Frage: Ist das der Staat, den seine Bürgerinnen und Bürger heute brauchen?

Alexander Görlach // Der Papst der Erwartungen & Hoffnungen
Nach dem Tod von Papst Franziskus stand die katholische Kirche am Scheideweg. Sollte sie sich mit dem neu zu wählenden Oberhaupt auf die traditionelle Stärke als Verkünderin göttlicher Wahrheiten berufen? Oder sollte sie Franziskus’ Weg der gesellschaftlichen Öffnung weitergehen?

Judy Born // „Schulen, sprecht mit euren Schülern!“
Demokratie lebt von Vielfalt und Engagement. Es gibt keinen besseren – Ort als die Schule, um Teilhabe zu lernen. Doch dafür müssen die Schulen sich stärker für die Lebenswelten junger Menschen öffnen.