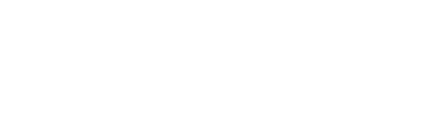Nach seiner Wahl tritt Papst Leo XIV. auf den Balkon des Petersdoms in Rom.
Religion
Der Papst
der Erwartungen
und Hoffnungen
Nach dem Tod von Papst Franziskus stand die katholische Kirche am Scheideweg. Sollte sie sich mit dem neu zu wählenden Oberhaupt auf die traditionelle Stärke als Verkünderin göttlicher Wahrheiten berufen? Oder sollte sie Franziskus’ Weg der gesellschaftlichen Öffnung weitergehen?
Text: Alexander Görlach
Papst Leo XIV. weckt weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus die Erwartung, in der gegenwärtigen weltpolitischen Situation ein Gegengewicht zu den illiberalen Kräften darzustellen. Vor allem die Tatsache, dass die Kardinäle im Konklave einen US-Amerikaner gewählt haben, nährt die Hoffnung, dass Leo als liberales Pendant zum autoritären Donald Trump agieren werde. Gibt Papst Leo wirklich Grund und Anlass zu dieser Hoffnung oder handelt es sich hier um einen frommen Wunsch?
Zum einen hat der Papst, als er noch Kardinal Robert Francis Prevost war, die Flüchtlingspolitik der US-Administration scharf kritisiert. Auf der anderen Seite hat er den, wie er es ausdrückte, „homosexuellen Lebensstil“ als Gefahr gebrandmarkt. Als Wähler war der Amerikaner Prevost bei den Republikanern und den Demokraten registriert, wenngleich häufiger bei der Grand Old Party als bei ihrem liberalen Mitbewerber.
Sein jahrzehntelanges Engagement als Priester und Bischof für die Ärmsten in Peru und die Wahl seines Namens legen den Schluss nahe, dass Leo XIV. ein Papst sein will, der sich für die Belange der Marginalisierten einsetzen wird. Namensvorgänger Leo XIII. antwortete vor mehr als einem Jahrhundert auf die prekäre Situation der Arbeiter im Industriezeitalter mit der Enzyklika „Rerum Novarum“, die bis heute als Grundlage der modernen katholischen Soziallehre gilt. Dieses Engagement für die Schwachen ergänzt Leo XIV. mit einem Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung – und knüpft damit an den verstorbenen Papst Franziskus an.

Nach seiner Wahl tritt Papst Leo XIV. auf den Balkon des Petersdoms in Rom.
Religion
Der Papst der Erwartungen und Hoffnungen
Nach dem Tod von Papst Franziskus stand die katholische Kirche am Scheideweg. Sollte sie sich mit dem neu zu wählenden Oberhaupt auf die traditionelle Stärke als Verkünderin göttlicher Wahrheiten berufen? Oder sollte sie Franziskus’ Weg der gesellschaftlichen Öffnung weitergehen?
Text: Alexander Görlach
Papst Leo XIV. weckt weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus die Erwartung, in der gegenwärtigen weltpolitischen Situation ein Gegengewicht zu den illiberalen Kräften darzustellen. Vor allem die Tatsache, dass die Kardinäle im Konklave einen US-Amerikaner gewählt haben, nährt die Hoffnung, dass Leo als liberales Pendant zum autoritären Donald Trump agieren werde. Gibt Papst Leo wirklich Grund und Anlass zu dieser Hoffnung oder handelt es sich hier um einen frommen Wunsch?
Zum einen hat der Papst, als er noch Kardinal Robert Francis Prevost war, die Flüchtlingspolitik der US-Administration scharf kritisiert. Auf der anderen Seite hat er den, wie er es ausdrückte, „homosexuellen Lebensstil“ als Gefahr gebrandmarkt. Als Wähler war der Amerikaner Prevost bei den Republikanern und den Demokraten registriert, wenngleich häufiger bei der Grand Old Party als bei ihrem liberalen Mitbewerber.
Sein jahrzehntelanges Engagement als Priester und Bischof für die Ärmsten in Peru und die Wahl seines Namens legen den Schluss nahe, dass Leo XIV. ein Papst sein will, der sich für die Belange der Marginalisierten einsetzen wird. Namensvorgänger Leo XIII. antwortete vor mehr als einem Jahrhundert auf die prekäre Situation der Arbeiter im Industriezeitalter mit der Enzyklika „Rerum Novarum“, die bis heute als Grundlage der modernen katholischen Soziallehre gilt. Dieses Engagement für die Schwachen ergänzt Leo XIV. mit einem Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung – und knüpft damit an den verstorbenen Papst Franziskus an.
Leo XIV. dürfte sich nicht als ein Liberaler im politischen oder gar parteipolitischen Sinne verstehen. Was an ihm, seiner Rhetorik und seinem Auftreten im säkularen Diskurs als liberal bezeichnet werden kann, gründet in seiner Spiritualität als Augustinermönch. Im Zentrum der Lehre des Augustinus von Hippo steht die Gemeinschaft. Um sie zu erhalten, bedarf es des Zuhörens, des Austauschs, des Aufeinanderzugehens und der Konsensbildung. Leo XIV. wird diese Spiritualität, die er als Mönch und Oberhaupt des Augustinerordens eingeübt hat, auf die katholische Weltkirche übertragen. Schon bei seiner ersten Ansprache nach seiner Wahl sprach er in diesem Sinne von einer „synodalen Kirche“.
Ein Erster unter Gleichen
Unter ihm sollen die 1,4 Milliarden Katholiken nicht von oben herab aus Rom regiert werden, sondern vom Kollegium der Bischöfe, die keine ewigen Wahrheiten wiederholen, sondern im Zuhören die gegenwärtige Welt verstehen. Er, der Papst, ist in diesem Konstrukt kein absoluter Herrscher, sondern „Primus inter Pares“, also Erster unter Gleichen. Dieser Blick auf das Papsttum rückt die katholische Kirche weg von der Vorstellung Joseph Ratzingers, der als Benedikt XVI. eine Kirche verkörperte, die verkündet und weiß.
Die Wahl Leos zum Nachfolger von Papst Franziskus illustriert, dass die gesamte Weltkirche (Kardinal Prevost erhielt weit mehr als die 89 zu seiner Wahl nötigen Stimmen) auf dieses Kirchenbild setzt. Mit diesem Ansatz hat er auch bei konservativen Kardinälen verfangen, die ihre Stimme für Leo nicht als eine Stimme für eine liberale Gesellschaft abgegeben haben, sondern für eine Kirche, in der auch sie gehört werden. Der Papst wird den traditionellen Flügel im Kardinalskollegium nicht missachten können.
In einer Zeit zunehmender politischer Konfrontation dürfte das Pontifikat Papst Leos XIV. eine mächtige Gegenstimme werden.
Diese binnenkirchliche liberale Synodalität bedeutet nicht, dass Leo XIV. Frauen zu Priesterinnen weihen oder eine Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einführen wird. Der Papst hat in seiner Laufbahn an keiner Stelle zu verstehen gegeben, dass er hier Handlungsbedarf sieht. Wohl aber wird er zuhören, moderieren und allein schon dadurch, dass dieses synodale Gespräch möglich sein wird, das Klima der Offenheit in der Weltkirche weiter befördern. Wo für Benedikt XVI. die „Diktatur des Relativismus“ am Werk war, sieht er eine Vielgestaltigkeit der Kirche. Dieser Ansatz lässt sich problemlos mit dem der liberalen Demokratie vereinbaren. Im Parlament werden keine ewigen Wahrheiten gefunden, sondern Lösungen für aktuelle Fragen errungen.
Hier liegt Leo XIV. tatsächlich über Kreuz mit US-Präsident Donald Trump und allen illiberalen und neoautoritären politischen Figuren der Gegenwart. Die Kardinäle haben Leo nicht als explizites Pendant zu Donald Trump gewählt, wohl aber als christlichen Gegenentwurf zu einer Bewegung, die von Brasilien bis zu den Philippinen bereits katholisch geprägte Nationen erreicht hat. Auch in den USA gibt es eine beträchtliche Zahl an Katholiken. Sie machen mittlerweile 20 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Die katholische Kirche sieht sich als weltumspannende Gemeinschaft, nicht als eine Nationalkirche. Die Kardinäle aus den USA gaben nach dem Konklave zu Protokoll, dass sie Robert Francis Prevost nicht als „amerikanischen Kardinal“ auf dem Zettel hatten. In der Tat hat Prevost nicht nur die peruanische Staatsangehörigkeit, er hat auch seit Jahrzehnten nicht mehr in den USA gelebt.
Unbequeme Positionen
Papst Leo ist, obwohl er einer religiösen Institution vorsteht, mit seinem von der augustinischen Spiritualität herkommenden Weltbild ein natürlicher Ansprechpartner demokratisch gewählter Politiker. Das könnte auch unbequem werden. Er ist der zweite Papst aus dem globalen Süden. Er hat die Auswüchse des Kapitalismus ebenso kritisiert wie den Rassismus und den Raubbau an der Natur. In diesem Sinne ist der Pontifex ein Akteur mit einer eigenen Agenda, die er nicht einem politischen Lager zuschlagen, sondern als seinen Auftrag aus dem Evangelium herleiten wird.
Die katholische Kirche ist ein Player auf der Weltbühne mit weitreichendem Einfluss. Die Aussagen zum Klimawandel und Naturschutz, die Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si’“ dargelegt hat, wurden etliche Male bei den Verhandlungen zum Pariser Klimaabkommen zitiert. Papst Leo hat seine Botschaft „Friede sei mit euch“, die er am Abend seiner Wahl an die Menschen auf dem Petersplatz richtete, wenig später flankiert mit der Bereitschaft, im Krieg Russlands gegen die Ukraine vermitteln zu wollen, und dafür weltweit positives Echo erhalten. In einer Zeit, in der politisch zunehmend auf Konfrontation und Dämonisierung von Andersdenkenden gesetzt wird, dürfte das Pontifikat Papst Leos XIV. die mächtigste Gegenstimme darstellen.
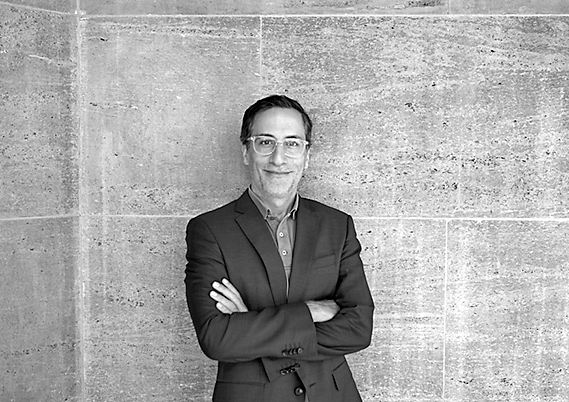
Alexander Görlach ist Honorar professor für Theologie und Ethik an der Leuphana Universität in Lüneburg. Er unterrichtet zudem Politische Philosophie an der New York University.
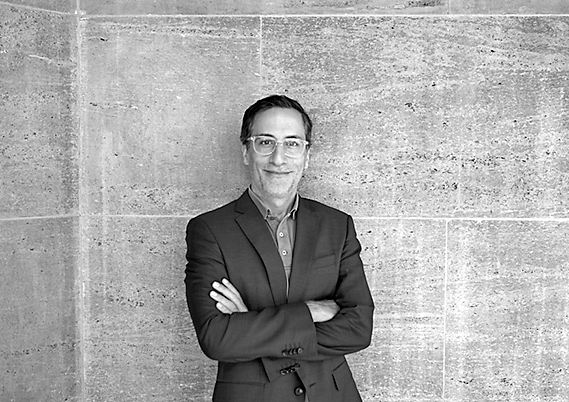
Alexander Görlach ist Honorarprofessor für Theologie und Ethik an der Leuphana Universität in Lüneburg. Er unterrichtet zudem Politische Philosophie an der New York University.
Auch interessant
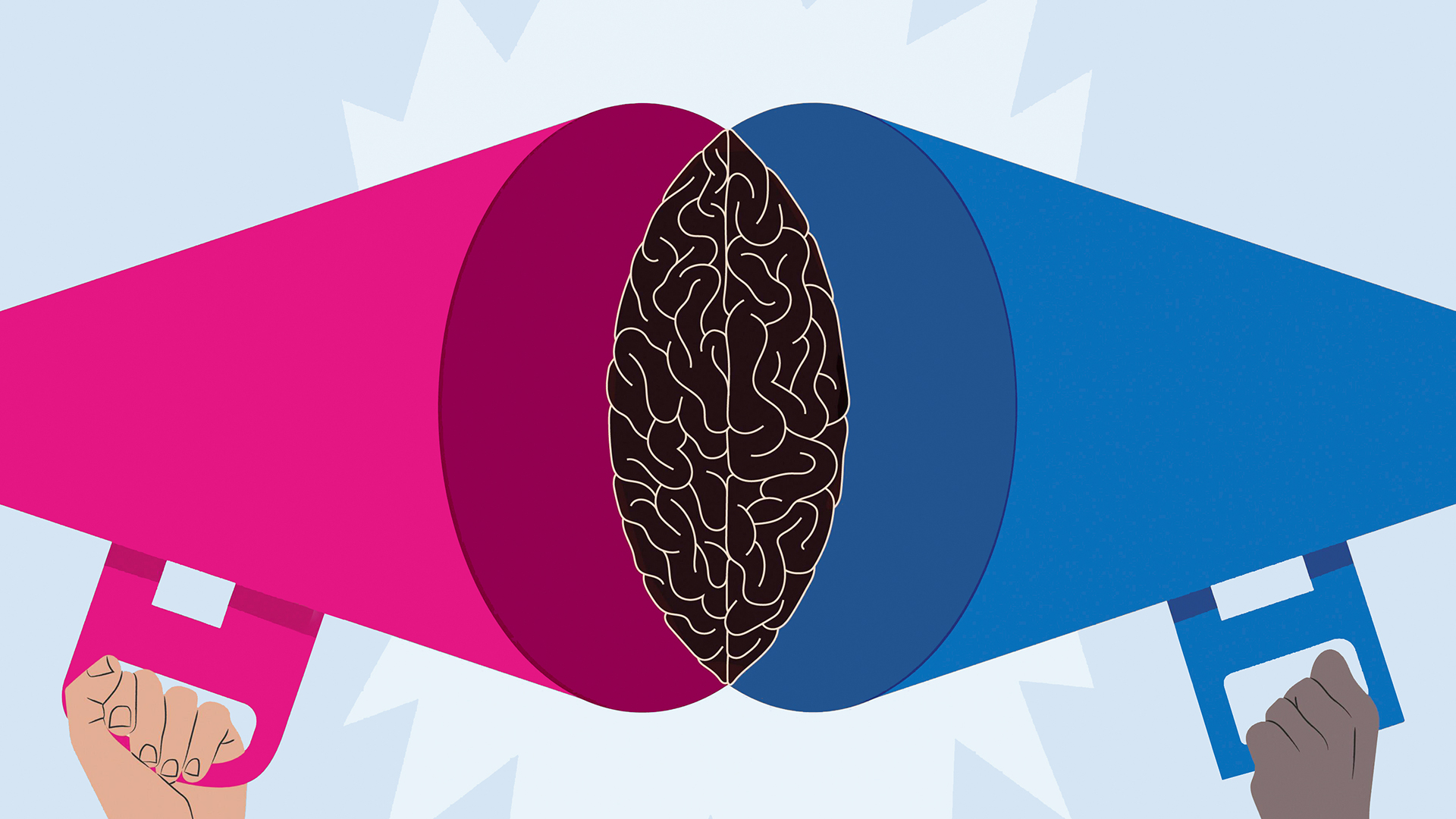
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger // „Hass ist keine Meinung“
Hasspostings sind kein Ausdruck von Meinungsfreiheit. Im Gegenteil: Beleidigungen und Bedrohungen schränken Meinungsfreiheit ein. Dagegen brauchen wir keine neuen Gesetze, sondern eine neue Streitkultur, die Toleranz nicht mit Beliebigkeit verwechselt.

Katharina Rudolph // „Was, wenn alles gut wird?“
Zwischen Klimakrise, Kriegen und gesellschaftlicher Polarisierung erscheint der Blick in die Zukunft oft düster. Hier setzt die Arbeit von Theresa Schleicher an. Sie ist Zukunftsforscherin mit dem Schwerpunkt Handel.

Judy Born // „Schulen, sprecht mit euren Schülern!“
Demokratie lebt von Vielfalt und Engagement. Es gibt keinen besseren – Ort als die Schule, um Teilhabe zu lernen. Doch dafür müssen die Schulen sich stärker für die Lebenswelten junger Menschen öffnen.