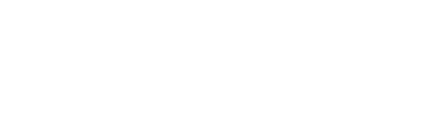Streitkultur
„Hass ist keine Meinung“
Hasspostings sind kein Ausdruck von Meinungsfreiheit. Im Gegenteil: Beleidigungen und Bedrohungen schränken Meinungsfreiheit ein. Dagegen brauchen wir keine neuen Gesetze, sondern eine neue Streitkultur, die Toleranz nicht mit Beliebigkeit verwechselt.
Text: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
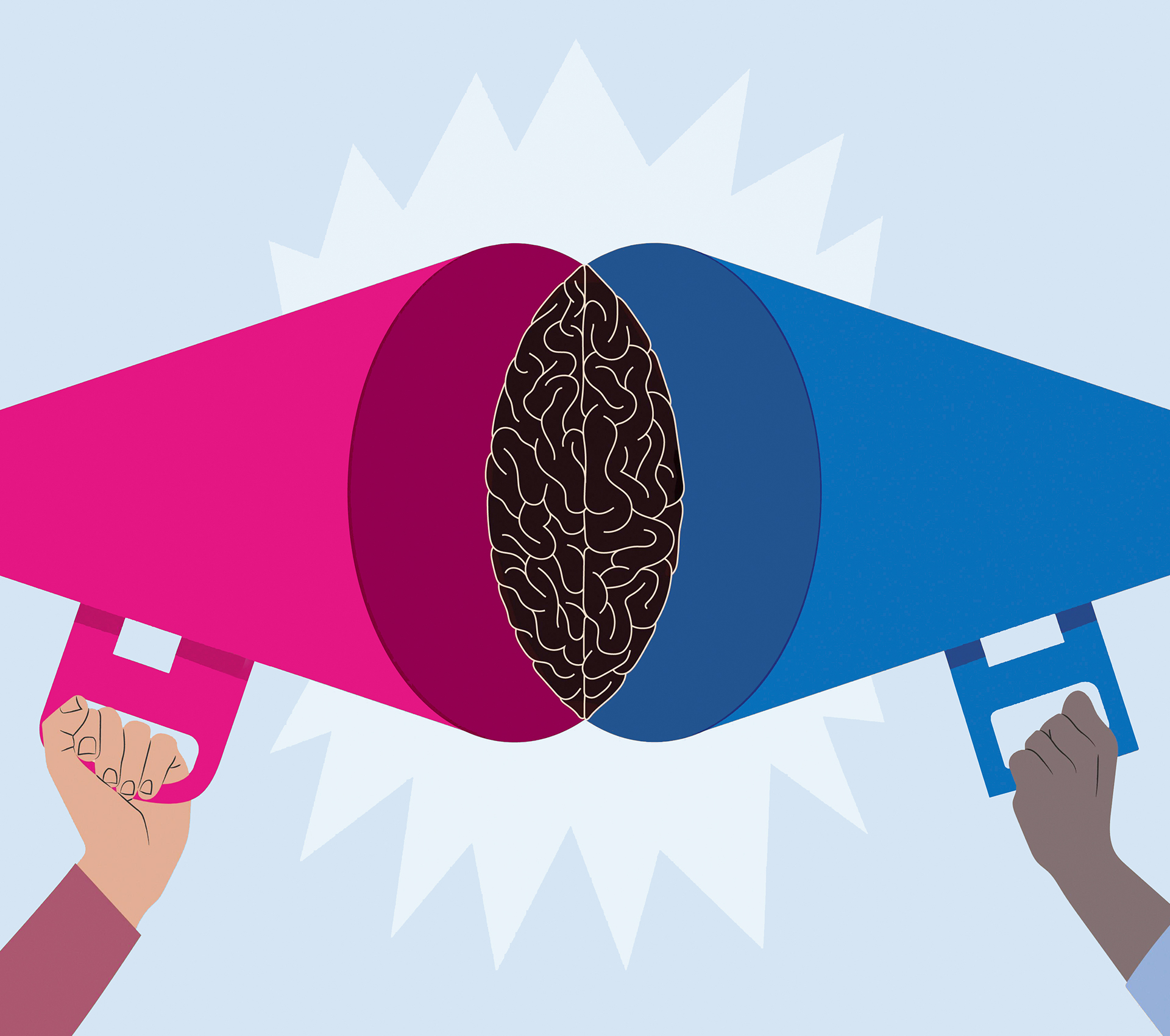
Streitkultur
„Hass ist keine Meinung“
Hasspostings sind kein Ausdruck von Meinungsfreiheit. Im Gegenteil: Beleidigungen und Bedrohungen schränken Meinungsfreiheit ein. Dagegen brauchen wir keine neuen Gesetze, sondern eine neue Streitkultur, die Toleranz nicht mit Beliebigkeit verwechselt.
Text: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
Deutschland – ein Land der Meinungsdiktatur? Wer den Schlagworten von Rechtspopulisten und Extremisten lauscht, könnte meinen, wir lebten längst in einem Klima der Zensur, der Unterdrückung kritischer Stimmen, gar in einer „DDR 2.0“. Das mutet reichlich absurd an, in einem Land, das zwei Diktaturen mit totaler Überwachung, Zensur und Unterdrückung politischer Meinungen überstanden hat. Das Gegenteil ist der Fall: Diese Behauptungen sind eine gefährliche Verzerrung und Ausdruck eines zwar freien, aber verantwortungslos geführten Diskurses.
Artikel 5 des Grundgesetzes ist eindeutig: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“ Dieses Grundrecht ist elementar für eine Demokratie – es schafft den Raum, in dem gesellschaftlicher Fortschritt, Kritik und Pluralismus gedeihen können. Doch es ist kein schrankenloses Recht. Derselbe Artikel setzt in Absatz 2 klare Grenzen: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“
Das bedeutet: Meinungsfreiheit endet dort, wo sie in die Rechte anderer eingreift. Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung – all das sind keine geschützten Meinungsäußerungen, sondern Straftatbestände. Und wie bei jedem Spannungsverhältnis zwischen Grundrechten gilt: Die Abwägung im Einzelfall ist komplex. Sie kann legitime Kritik an Strafverfolgung und Gerichtsentscheidungen provozieren – sowohl dort, wo sie als übergriffig, als auch dort, wo sie als zu lasch empfunden wird. Die Debatte um das Urteil im Fall Renate Künast ebenso wie die polizeiliche Durchsuchung bei einem Mann, der Bundesminister Habeck als „Schwachkopf“ beschimpfte, zeigen diese Ambivalenz.
Zivilcourage ist gefordert
Doch jenseits von Einzelfällen sollten wir uns die Frage stellen, worin die eigentlichen Herausforderungen für die Meinungsfreiheit liegen. Ein Blick auf die Zahlen hilft, Mythen zu entlarven. Die politisch motivierte Kriminalitätsstatistik des Jahres 2024 verzeichnete einen Anstieg der Hasskriminalität um 28 Prozent – auf 21 773 Fälle. Mehr als ein Viertel aller politisch motivierten Straftaten lässt sich damit dem Hass zuordnen. Besonders im digitalen Raum wächst die Problematik: Allein 10 732 Straftaten wurden im Zusammenhang mit sogenannten Hasspostings erfasst – ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Meinungsfreiheit bedrohen nicht jene, die sich für respektvollen Umgang einsetzen. Sondern die, die systematisch mit Verachtung und gezielter Desinformation arbeiten.
Diese Zunahme ist alarmierend. Denn Hass und Desinformation im Netz bleiben nicht folgenlos. Sie beeinflussen Meinungsbildungsprozesse, verschieben gesellschaftliche Normen und fördern eine Atmosphäre der Einschüchterung. Menschen, die sich äußern – insbesondere in politischen Kontexten –, berichten zunehmend davon, sich einem Tsunami aus Beschimpfungen und Bedrohungen ausgesetzt zu fühlen. Das lähmt. Es fördert Selbstzensur. Und es gefährdet den offenen Diskurs, auf den unsere Demokratie angewiesen ist.
Die repräsentativen Zahlen bestätigen das Unbehagen: Laut einer Umfrage des Instituts Allensbach fühlten sich 2024 nur noch 40 Prozent der Deutschen frei, ihre Meinung öffentlich zu sagen – halb so viele wie noch 1990. Es geht hier nicht um juristische Zensur, sondern um eine soziale Dynamik der Einschüchterung. Die Grenze verläuft nicht entlang eines Gesetzes, sondern mitten durch das gesellschaftliche Klima.
Besonders betroffen sind jene, die sich politisch engagieren. Doch gerade sie müssen sich frei äußern können – auch mal unperfekt, zugespitzt, polemisch. Machtkritik gehört zum demokratischen Alltag. Politikerinnen und Politiker sind keine sakrosankten Figuren. Doch wenn ihnen mit Gewalt, Verleumdung oder der Drohung gegen Leib und Leben begegnet wird, wenn ihre Wohnadressen veröffentlicht oder ihre Autoreifen zerstochen werden, dann kippt der Diskurs. Die Voraussetzungen, unter denen Meinungsfreiheit gelebt werden kann, sind dann nicht mehr gegeben.
Hier stößt aber selbst das Strafrecht an seine Grenzen. Denn es verfolgt in erster Linie individuelle Verstöße und schützt nicht das Gemeinwesen als Ganzes. Gegen (digitale) Verrohung hilft kein härteres Strafmaß, sondern eine stärkere gesellschaftliche Reaktion. Wer betroffen ist, braucht Rückhalt – nicht nur von Gerichten, sondern auch von Nachbarn, Kolleginnen, politischen Gegnern. Es braucht den Mut, sich schützend vor Menschen zu stellen, die sich äußern, auch wenn man ihre Meinung nicht teilt. Es braucht Solidarität statt Schweigen. Das ist unbequem. Aber notwendig.
Leider erleben wir oft das Gegenteil. Während über neue Strafgesetze debattiert wird, bleiben viele still. Vielleicht aus Angst, selbst ins Visier zu geraten. Vielleicht auch, weil es leichter ist, Empörung zu inszenieren, als Zivilcourage zu zeigen.
Wir brauchen keine neuen Gesetze. Wir brauchen ein erneuertes Verständnis von demokratischer Streitkultur. Wir brauchen eine Streitkultur, die klar zwischen Kritik und Hetze unterscheidet. Die Toleranz nicht mit Beliebigkeit verwechselt, aber auch Widerspruch nicht mit Unterdrückung. Und die weiß, dass Meinungsfreiheit nicht darin besteht, unwidersprochen alles sagen zu dürfen – sondern sich auf den Gegenwind einzulassen.
Natürlich gibt es auch echte Gefahren für die Meinungsfreiheit. Aber sie kommen nicht von jenen, die sich für respektvollen Umgang und einen faktenbasierten Diskurs einsetzen. Sondern von jenen, die systematisch mit Verachtung, Manipulation und gezielter Desinformation arbeiten – oft aus dem Ausland, oft mit autoritärem Hintergrund. Dort, wo Inhalte auf Social-Media-Plattformen staatlich kontrolliert, oppositionelle Inhalte gelöscht und freie Rede mit Gefängnis beantwortet werden, erleben wir die reale Erosion der Meinungsfreiheit.
Ja, Meinungsfreiheit muss verteidigt werden – aber bitte mit Augenmaß. Nicht mit Verharmlosungen autoritärer Regime. Nicht mit historisch entgleisten Vergleichen à la Sophie Scholl. Sondern mit der Bereitschaft, sich dem anstrengenden Teil der Freiheit zu stellen: der Verantwortung. Denn Meinungsfreiheit ist kein Selbstläufer. Sie lebt davon, dass wir sie leben. Dass wir sie anderen zugestehen. Und dass wir uns einmischen, wenn sie bedroht wird – durch Angst, durch Hass, durch Schweigen.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Die Juristin war zweimal Bundesjustizministerin. Heute setzt sie sich für Bürgerrechte und liberale Freiheiten ein.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Die Juristin war zweimal Bundesjustizministerin. Heute setzt sie sich für Bürgerrechte und liberale Freiheiten ein.
Auch interessant

Sophie Eichhorn // Der Preis der Unfreiheit ist immer höher als der Preis der Freiheit
Seine Exzellenz Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine, hält die 19. Berliner Rede zur Freiheit.

Katharina Rudolph // „Was, wenn alles gut wird?“
Zwischen Klimakrise, Kriegen und gesellschaftlicher Polarisierung erscheint der Blick in die Zukunft oft düster. Hier setzt die Arbeit von Theresa Schleicher an. Sie ist Zukunftsforscherin mit dem Schwerpunkt Handel.

Judy Born // „Schulen, sprecht mit euren Schülern!“
Demokratie lebt von Vielfalt und Engagement. Es gibt keinen besseren – Ort als die Schule, um Teilhabe zu lernen. Doch dafür müssen die Schulen sich stärker für die Lebenswelten junger Menschen öffnen.