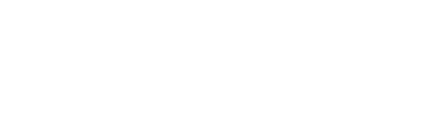Optimismus
„Was, wenn alles gut wird?“
Zwischen Klimakrise, Kriegen und gesellschaftlicher Polarisierung erscheint der Blick in die Zukunft oft düster. Hier setzt die Arbeit von Theresa Schleicher an. Sie ist Zukunftsforscherin mit dem Schwerpunkt Handel und sagt: „Wir sind in einer Jammerkultur gefangen.“ Im Gespräch erklärt sie, welche Entwicklungen unsere Wirtschaft sowie unser Zusammenleben prägen – und wie wir durch Kreativität und Optimismus zu neuer Stärke finden können.
Interview: Katharina Rudolph


Optimismus
„Was, wenn alles gut wird?“
Zwischen Klimakrise, Kriegen und gesellschaftlicher Polarisierung erscheint der Blick in die Zukunft oft düster. Hier setzt die Arbeit von Theresa Schleicher an. Sie ist Zukunftsforscherin mit dem Schwerpunkt Handel und sagt: „Wir sind in einer Jammerkultur gefangen.“ Im Gespräch erklärt sie, welche Entwicklungen unsere Wirtschaft sowie unser Zusammenleben prägen – und wie wir durch Kreativität und Optimismus zu neuer Stärke finden können.
Interview: Katharina Rudolph
Frau Schleicher, angesichts der vielen weltweiten Krisen wirkt die Welt von morgen zunehmend bedrohlich. Was macht das mit uns?
Die Leute haben Angst. Los ging es rund um Fridays for Future, da war die Sorge groß, dass kommende Generationen nicht überleben. Dann kam Corona und die Menschen waren sehr verunsichert, die Themen Gesundheit und Sicherheit haben viele bewegt. Im letzten Jahr stand finanzielle Sicherheit im Fokus: Haben wir überhaupt noch eine Rente? Wie geht es weiter in Deutschland? Und heute treibt uns natürlich die Angst vor Kriegen um. Das alles hat viele gelähmt, es gab eine Art kognitive Erschöpfung.
Welche Folgen hatte diese Erschöpfung?
Die wenigsten haben etwas gemacht, viele Unternehmen haben erst einmal abgewartet. Wir sind in Deutschland nicht wirklich vorangekommen und befinden uns in einer ganz anderen Reifephase als Märkte wie China. Über viele Jahre sind wir gewachsen und haben uns Wohlstand aufgebaut, aber mittlerweile sind wir träge geworden. Wie jemand, der zu viele Chips auf dem Sofa gegessen hat und weiß, er müsste mal joggen gehen – aber der Anfang ist eben schwer.
Wir Deutschen haben also zu wenig Elan und beklagen uns vielleicht auch zu viel?
Ja, wir sind in einer regelrechten Jammerkultur gefangen. Auch die Medien sehe ich da kritisch: Jede Headline ist negativ. So machen wir unsere Gesellschaft kaputt. Wir kommen viel zu langsam ins Tun. In den letzten vier Jahren waren wir in einer kompletten Lähmung. Und dann wundert man sich, wenn Unternehmen ins Ausland gehen. Das hängt natürlich nicht nur mit der negativen Stimmung zusammen, aber sie trägt eben auch nicht dazu bei, dass Menschen Lust haben, hierzulande Innovationen voranzubringen.
Und was braucht es für eine aktivere Gesellschaft?
Es ist ein bisschen wie mit der Steuer: Erst wenn die dritte Mahnung kommt, bewegt man sich. Genau an so einem Punkt stehen wir gerade, und wir werden uns neu erfinden müssen. Dazu gehört auch, dass wir lernen, wieder stolz auf das zu sein, was wir in Deutschland aufgebaut haben. Lokalstolz trauen sich viele Deutsche aber nicht – historisch aus Angst, in die Nazi-Ecke gestellt zu werden, oder weil es heißt: In dieser Krisenzeit, wie kann man da stolz sein?
Welche positiven Effekte hätte es, wenn wir mehr Stolz entwickeln würden?
Dass man sich klar zum Standort Deutschland bekennt. Für ein Unternehmen zum Beispiel würde es bedeuten, stärker in diesen Markt zu investieren – und nicht nur in vermeintlich günstigere. Dazu gehört auch, dass wir lernen, uns von Altem zu trennen, auch wenn’s wehtut. Wo investieren wir wirklich und wo nicht? Die Menschen müssen auch verstehen, was es bedeutet, wenn man zum Beispiel nur noch chinesische Autos kauft. Welche Folgen hat das für die eigenen Kinder, die in Zukunft in Deutschland auch sichere Jobs, eine Rente und ein gutes Leben wollen?
Welchen Einfluss haben Klimawandel und Ressourcenknappheit auf all das?
Die Situation wird sich in den nächsten Jahren zuspitzen. Es wird stärker um Länder gebuhlt werden, die Seltene Erden haben. Je knapper die Ressourcen, desto teurer werden sie und desto angespannter wird es am internationalen Mächtetisch. Mithalten können wir nur durch Aufrüstung. Damit meine ich nicht unbedingt militärisch – wobei ich das durchaus auch sehe –, sondern vor allem technologisch. Wir müssen KI-Innovationen voranbringen und wirtschaftlich stark bleiben. Nur so können wir auch unsere Werte in die globale Ordnung einbringen – und das wird in Zukunft enorm wichtig sein.
Gibt es Unterschiede zwischen den Generationen in Deutschland?
Weniger als man denkt. Die Generation Z hat in den letzten Jahren viel vorangetrieben, in Bereichen wie Nachhaltigkeit oder Work-Life-Balance. Und sie gilt als technologisch versiert. De facto waren es aber die Leute der Generation Y und X, die Technologien rund um KI in den Markt gebracht haben. Aktuell haben sich die Generationen mehr angeglichen. Alle sitzen im selben globalen Krisenboot. Und die Gen Z merkt beispielsweise gerade, dass es nicht immer nur um Selbstverwirklichung geht, sondern auch um finanzielle Sicherheit.
Um noch mal auf das Thema Jammern zurückzukommen: Ein Bereich, in dem ja viel geklagt wird, ist die Stadtentwicklung. Wie sehen Sie als Handelsexpertin die Zukunft unserer teils verödeten Zentren?
Die Frage ist: Wie bringen wir Leben und Frequenz in die Stadtkerne? Es passiert bereits einiges, aber wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir bezahlbaren zentralen Wohnraum schaffen. Niemand will ewig fahren, um von zu Hause in die Stadt zu kommen. Es braucht Restaurants, die nicht nur Touristen anziehen und die für Betreiber wie Gäste finanzierbar sind. Es geht schon stark darum, wie es um unsere Wirtschaft bestellt ist. Auch blockieren hohe Auflagen, etwa im Denkmalschutz, in vielen kleinen Städten die Entwicklung. Wir brauchen mehr Spielraum für neue Ideen. Stadtplanung, Marketing und Handel müssen gemeinsam überlegen: Wie schaffen wir wieder Glanzpunkte?
Was wären solche Glanzpunkte?
Bekannte Marken, mehr Grünflächen, ungewöhnliche Foodkonzepte, Wellness-Angebote, Erlebnisorte. Vieles davon will sich aber kaum jemand leisten, weil die Leute denken, es kommt ja eh niemand. So bleibt es beim Einheitsbrei. Die Menschen wollen aber überrascht werden. Anstatt immer gleiche Schaufenster zu machen, könnte man überlegen, wie jedes anders aussehen kann – zum Beispiel mit Installationen von Künstlern. Das muss nicht für jede deutsche Stadt passen, aber es geht darum, den Menschen vor Ort Spaß zu bereiten. Gerade jetzt bräuchte es – aus unternehmerischer Notwendigkeit – mehr Mut und Kreativität: durch Konzepte, die lokal funktionieren. Wenn alles gleich aussieht, verlieren die Leute das Interesse und bestellen lieber online oder kaufen gar nicht mehr.
Bei Instagram haben Sie mal ein Bild gepostet, auf dem steht: „Und was, wenn alles gut wird?“ Was steckt dahinter?
Die Frage ist: Worauf willst du im Leben schauen? Wir leben in einer Zeit, in der beim Konsum vor allem Rabatte zählen – nicht die Wertschätzung für das Produkt. Gesellschaftlich geht es um Negativschlagzeilen. Aus Negativität entstehen aber keine Lösungen, das hat noch nie geklappt. Ja, 2/3 der Deutschen haben Angst vor der Zukunft. Gleichzeitig sind aber fast genauso viele mit ihrer Situation zufrieden. Das zeigt, dass vieles gut läuft. Gerade jetzt sehen wir im globalen Vergleich, wie wertvoll ein gutes Gesundheitssystem und demokratische Werte sind. Bei all der Willkür in der Welt wird einem bewusst, wie sicher und stabil es hier ist. Dann sollte es auch okay sein, wenn die Bahn mal 20 Minuten später kommt … Statt weiter zu jammern, sollten wir gemeinsam anpacken. Wir stehen für Werte ein, suchen Lösungen – nicht aus Aggression, sondern im Miteinander, auch innerhalb der EU. Das haben wir uns erarbeitet. Und wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, können wir aus diesem Gefühl heraus neuen Wohlstand gestalten!

Katharina Rudolph ist freiberufliche Journalistin in Berlin. Sie schreibt über Kunst, Design, Literatur und Architektur.

Katharina Rudolph ist freiberufliche Journalistin in Berlin. Sie schreibt über Kunst, Design, Literatur und Architektur.
Auch interessant
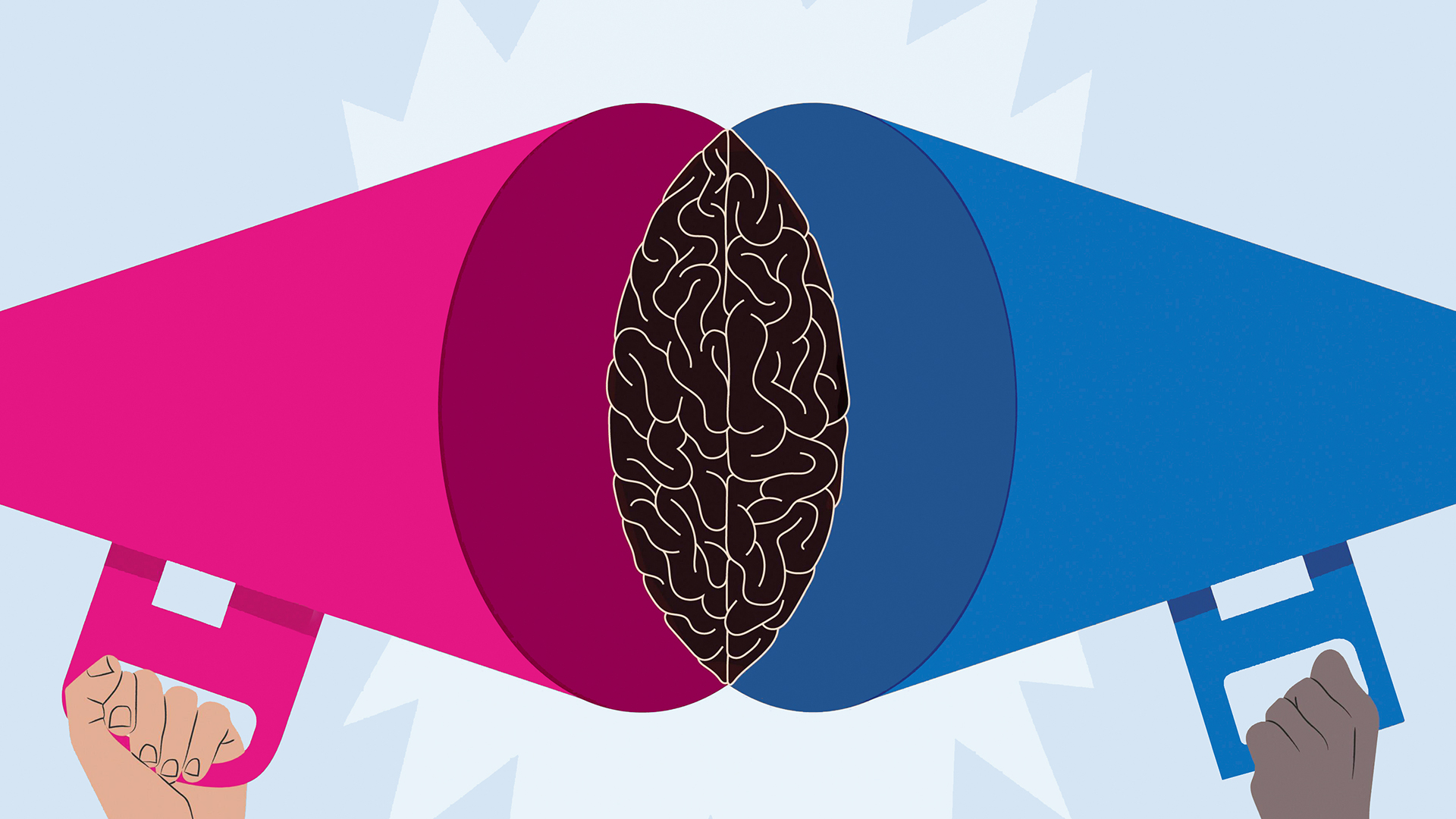
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger // „Hass ist keine Meinung“
Hasspostings sind kein Ausdruck von Meinungsfreiheit. Im Gegenteil: Beleidigungen und Bedrohungen schränken Meinungsfreiheit ein. Dagegen brauchen wir keine neuen Gesetze, sondern eine neue Streitkultur, die Toleranz nicht mit Beliebigkeit verwechselt.

Sophie Eichhorn // Der Preis der Unfreiheit ist immer höher als der Preis der Freiheit
Seine Exzellenz Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine, hält die 19. Berliner Rede zur Freiheit.

Judy Born // „Schulen, sprecht mit euren Schülern!“
Demokratie lebt von Vielfalt und Engagement. Es gibt keinen besseren – Ort als die Schule, um Teilhabe zu lernen. Doch dafür müssen die Schulen sich stärker für die Lebenswelten junger Menschen öffnen.