Gleichberechtigung auf französisch
Französinnen sind elegante Superfrauen, und deutsche Mütter bleiben daheim am Herd? Das ist ein überholtes Klischee. Aber in Sachen Gleichberechtigung ist Frankreich tatsächlich weiter.
TEXT: CÉCILE CALLA
ILLUSTRATION: EMMANUEL POLANCO/SEPIA
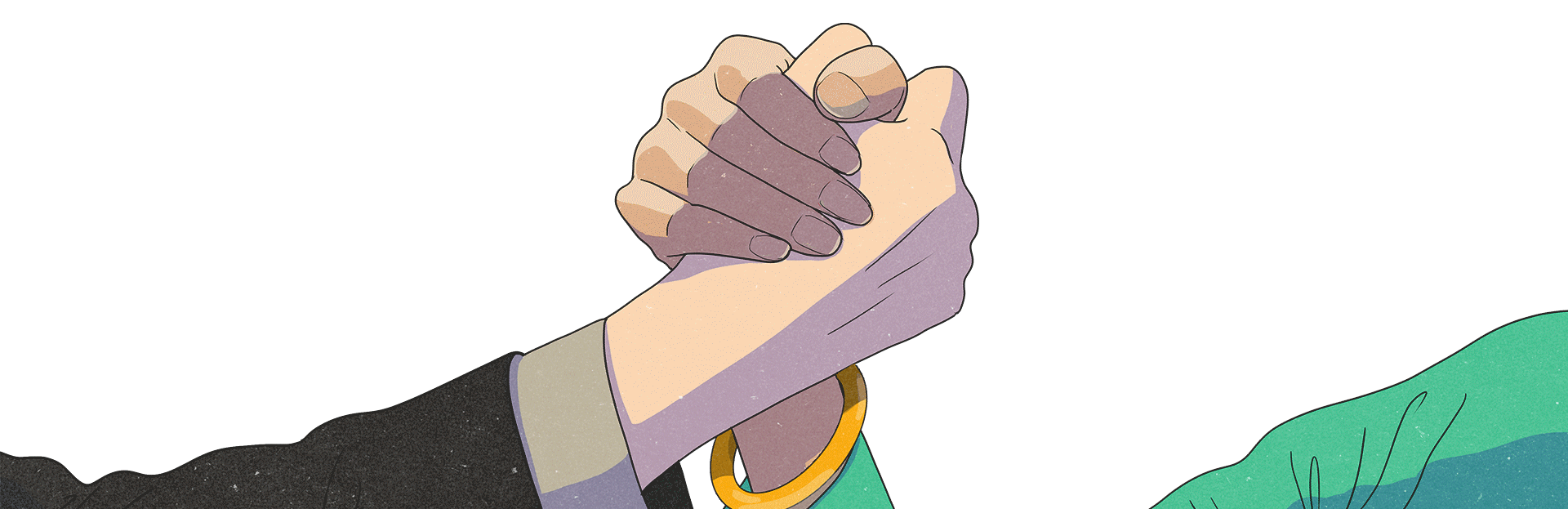
Gleichberechtigung auf französisch
Französinnen sind elegante Superfrauen, und deutsche Mütter bleiben daheim am Herd? Das ist ein überholtes Klischee. Aber in Sachen Gleichberechtigung ist Frankreich tatsächlich weiter.
TEXT: CÉCILE CALLA
ILLUSTRATION: EMMANUEL POLANCO/SEPIA

Nur wenige Länder haben ein so enges Verhältnis wie Deutschland und Frankreich. Der Dialog ist rege. Nur ein gesellschaftliches Anliegen bleibt fast komplett unerwähnt: Gleichberechtigung und Frauenrechte. Stattdessen spiegeln sich in der Diskussion über die Landesgrenzen hinweg Klischees: Die Französinnen alias Superfrauen vermögen Karriere und Familie perfekt zu vereinbaren, sind Freigeister und stets elegant. Deutsche Frauen leben immer noch im Zeitalter der drei K (Kinder, Küche, Kirche) und bleiben zu Hause, sobald sie Mutter werden. Die Realität sieht anders aus, und das Schweigen zu Gleichberechtigung und Frauenrechten ist umso erstaunlicher, als in beiden Ländern ähnliche Debatten laufen: über Sexismus und sexualisierte Gewalt, über Frauenquoten in Unternehmensvorständen und Verwaltungssräten, über Lohnungleichheit und die „gläserne Decke“.
Lawine von Veröffentlichungen
Die Debatte über sexualisierte Gewalt und Sexismus ist in Frankreich stark politisiert. Als im Herbst 2017 die #MeToo-Welle ausbrach, fingen unzählige Frauen an, über Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und Sexismus zu sprechen; es fielen bekannte und unbekannte Namen. Kurz darauf erklärte Staatspräsident Emmanuel Macron die Gleichberechtigung zur Priorität seiner Amtszeit. In den folgenden Jahren erlebte das Phänomen der Femizide (Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechtes) ein beispielloses Medieninteresse. Eine Lawine von Enthüllungen zu sexuellen Übergriffen, in die Prominente verwickelt waren, rollte über das Land. Zuletzt ging es um den Starjournalisten Patrick Poivre d’Arvor und den ehemaligen Umweltminister Nicolas Hulot.
Was oft als Kultur der sexuellen Offenheit beschrieben worden war, erwies sich nun als verfehlte Toleranz gegenüber Übergriffen und Machtmissbräuchen. Der Wind hat sich gedreht. Das offensive Machotum, das in Frankreich im Vergleich zu Deutschland noch verbreitet ist, hat an Attraktivität verloren. In den zurückliegenden Jahren haben wichtige emanzipatorische Reformen stattgefunden. So ist im September das Gesetz „La PMA pour toutes“ (Künstliche Befruchtung für alle) in Kraft getreten, das allen Frauen, auch alleinstehenden und lesbischen, Zugang zur künstlichen Befruchtung gibt wie auch das Recht, ihre Eizellen zum späteren Gebrauch einzufrieren.
In Deutschland sind solche Fragen rund um den weiblichen Körper selten Gegenstand politischen Engagements von höchster Stelle – es sei denn, die Täter sexueller Übergriffe sind Ausländer, wie in der Silvesternacht 2015/16, in der Hunderte von Frauen in Köln von jungen Männern aus Nordafrika sexuell bedrängt und angegriffen wurden. Nur einen einzigen Kommentar zu #MeToo ließ die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel im Dezember 2017 von ihrem Sprecher auf Twitter veröffentlichen. In die Debatte über die Reform des Sexualstrafrechts „Nein heißt nein” im Jahr 2016 hat sie sich nie eingeschaltet. Selbst über Femizide spricht man erst seit wenigen Jahren.
Kontroverse um ein Paritätsgesetz
Dennoch ist ein Wandel in den Köpfen spürbar. Anfang November 2021 kam die erste große empirische Studie zum Thema Sexismus in der Politik heraus, durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF). Darin klagen die befragten Politikerinnen in Deutschland zu 40 Prozent – im Alter unter 45 Jahren sogar zu 60 Prozent – über sexuelle Belästigung im Alltag. Das ist mit einer unzureichenden Repräsentation von Frauen in politischen Ämtern schwer zu bekämpfen. Der Frauenanteil im neuen Bundestag hat sich zwar mit 34,7 Prozent etwas erhöht, von einer Parität ist man aber noch weit entfernt. Auf der kommunalen Ebene sieht es mit nur 15 Prozent Frauen noch düsterer aus. Daher werden Forderungen für ein Paritätsgesetz wieder laut, ein bis heute sehr kontroverses Thema.
Die Kontroverse verläuft in beiden Ländern über Frauenquoten ähnlich, aber die Argumente unterscheiden sich deutlich.
Mehr Frauen
Diesen Weg hat Frankreich schon lange eingeschlagen. Dort gibt es seit 2001 ein Paritätsgesetz. Damals waren nur 10,9 Prozent der Abgeordneten in der Assemblée Natio-
nale Frauen. Seit 2017 sind es 39 Prozent. Auf regionaler und kommunaler Ebene ist der Anteil mit oft mehr als 40 Prozent etwas größer. Für die Verwaltungsräte von Unternehmen hatte der Gesetzgeber 2011 vorgeschrieben, dass bis 2019 eine Quote von 40 Prozent herbeizuführen sei. Ein neues Gesetz, das noch den Senat passieren muss, soll zudem mehr Frauen in die Führungsetagen großer Unternehmen bringen.
In Deutschland, wo man viel länger auf freiwillige Maßnahmen gesetzt hat, wurde erst 2015 eine Frauenquote von 30 Prozent in den Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen eingeführt. Doch der Frauenanteil blieb dort trotzdem hoffnungslos niedrig: Im Jahr 2017 waren es erst 7,7 Prozent. Deshalb wurde das Gesetz 2021 reformiert; die neue Fassung trat im August in Kraft.
Die Diskussionen über diese Themen verlaufen in beiden Ländern ähnlich kontrovers, aber die Argumente unterscheiden sich deutlich. In Frankreich werden emanzipatorische Reformvorhaben zumeist mit dem Grundsatz der „Égalité“ (der Gleichheit) als Bestandteil des republikanischen Universalismus verteidigt. Zudem erleichtert die zentralistische Struktur des Landes solche Reformen. In Deutschland sehen nach wie vor viele Gegner das Prinzip der Wahlfreiheit verletzt und verweisen auf verfassungsrechtliche Hürden. Solche gab es jeweils auch auf der anderen Seite des Rheins, doch sie ließen sich überwinden. Am Ende zählt der politische Wille.
Die Ampelkoalition hat erkennen lassen, dass sie feministischen Anliegen eine ganz andere Bedeutung beimisst als die Vorgängerregierung. Darauf deutet das Vorhaben hin, den Paragrafen §219a zu streichen, der Ärztinnen und Ärzte bestraft, die auf ihrer Webseite darüber informieren, auf welche Weise sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Wenn ein lesbisches Paar ein Kind bekommt, sollen zudem beide Frauen den rechtlichen Mutterstatus erhalten können. Die Politik scheint somit endlich die gesellschaftliche Wende nachzuvollziehen. Vielleicht werden dann auch diese Fragen einen größeren Platz im deutsch-französischen Dialog einnehmen.

Cécile Calla ist freie Journalistin in Berlin.
