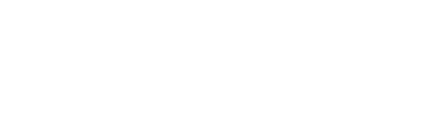Liberale Erneuerung
Die Suche nach
dem Feuer der Freiheit
Der Liberalismus wirkt erschöpft. Auch geistig steckt er im Leerlauf: Auf den immer gleichen Konferenzen versuchen die inzwischen ergrauten Eminenzen, ihren angestaubten Ideen noch einmal Leben einzuhauchen. Andere Denkschulen haben uns gerade bei jungen Menschen längst den Rang abgelaufen. Vier Impulse für einen Liberalismus im Aufbruch.
Text: Sven Gerst | Illustration: Mario Wagner

Liberale Erneuerung
Die Suche nach
dem Feuer der Freiheit
Der Liberalismus wirkt erschöpft. Auch geistig steckt er im Leerlauf: Auf den immer gleichen Konferenzen versuchen die inzwischen ergrauten Eminenzen, ihren angestaubten Ideen noch einmal Leben einzuhauchen. Andere Denkschulen haben uns gerade bei jungen Menschen längst den Rang abgelaufen. Vier Impulse für einen Liberalismus im Aufbruch.
Text: Sven Gerst | Illustrationen: Mario Wagner
Seit dem legendären Schlagabtausch zwischen John Rawls und Robert Nozick in den 1970er-Jahren hat sich innerhalb der liberalen Philosophie erstaunlich wenig bewegt. Statt neuer Entwürfe dominiert die Exegese alter Texte. Man könnte fast spotten, dass die Rawls-iologie der zeitgenössischen politischen Theorie ebenso hermeneutisch abgeriegelt funktioniert wie der politisch organisierte Liberalismus selbst. Währenddessen hat sich die Welt verändert: Globalisierung, Digitalisierung, Klima, Populismus und Geopolitik stellen Fragen, auf die der Liberalismus nur mühsam Antworten findet. Man wirkt aus der Zeit gefallen.
Dabei war gerade Anpassungsfähigkeit einst eine liberale Tugend. Es waren Denker wie Arendt, Berlin, Popper und Shklar, die nach 1945 eine Freiheitslehre entwarfen, die zur Nachkriegszeit passte: ein Liberalismus der Abwehr gegen Totalitarismus, Tyrannei und gesellschaftliche Utopie. Doch diese Erzählung hat sich überlebt. Sie wirkt zu eng, zu defensiv und zu wenig emanzipatorisch. Der Historiker Samuel Moyn argumentiert in seinem Buch „Der Liberalismus gegen sich selbst“ durchaus überzeugend: Der Liberalismus hat sich von seinen eigenen Versprechen entfremdet.
Gerade im deutschsprachigen Raum ist das intellektuelle Vakuum spürbar. Nach den Glanzzeiten von Ordoliberalismus und Österreichischer Schule, nach Hayek, Popper und Dahrendorf, fehlen heute neue Impulsgeber. So lohnt sich ein Blick in den angelsächsischen Raum: Dort entstehen Debatten mit Erneuerungspotenzial. Vier Strömungen stechen heraus.
Abundance Liberalism:
Die Fülle der Freiheit
Knappheit ist kein Naturgesetz, sondern politisches Versagen: Das ist die zentrale These von Ezra Klein und Derek Thompson in ihrem Buch „Abundance“ (im Deutschen etwas sperrig „Der neue Wohlstand“). Inspiriert von den sogenannten Cornucopians wie Julian Simon, entwerfen sie ein liberales Denken, das sich nicht mit dem Verwalten von Bestehendem zufriedengibt, sondern auf Wachstum setzt: Build, Build, Build!
Mehr Wohnraum, mehr Energie, mehr Forschung. Dafür: weniger Genehmigungsdschungel, weniger Bürokratie, weniger Verzichtsrhetorik.
Die Idee dahinter ist so simpel wie kernliberal: Wer Zukunft gestalten will, muss nicht nur gerechter verteilen; er muss mehr schaffen. Und gemeint ist nicht nur mehr Wohlstand, sondern auch Wohnungen, Strom und Netze, Straßen und Züge, Labore. Wer das Buch liest, merkt schnell: Vieles ist stark auf den US-amerikanischen Kontext zugeschnitten. Umso wichtiger ist es, diese Denkanstöße in den deutschen Raum zu übertragen. Schon allein ein wirklich passendes deutsches Wort für „Abundance“ gibt es nicht. Entscheidender ist die inhaltliche Übersetzung: Wie könnte eine liberale Angebotsoffensive hierzulande aussehen? Wie kann man Deregulierung, Infrastruktur, Industriepolitik und Technologieförderung zusammendenken?
Die Botschaft ist klar: Ohne entschlossenen Angebotsschub verliert die soziale Marktwirtschaft ihren Wohlstandspuffer – und damit ihre politische Mitte. Abundance Liberalism liefert das Vokabular, um liberale Tatkraft mit progressiver Zukunftslust zu verbinden. Ohne in die Naivität eines blinden Techno-Optimismus zu verfallen.
State-Capacity Liberalism:
Für ein freiheitliches Staatsbild
Liberale stilisieren den Staat gern zur Ursache allen Übels. Was Kritiker dann als naive Marktgläubigkeit abtun, ist in Wahrheit meist Ausdruck eines eher trivialen Staatsverständnisses. Zu wenige liberale Denker haben sich wirklich damit auseinandergesetzt, was ein funktionierender Staat leisten könnte und sollte.
Der Ökonom Tyler Cowen will den Liberalismus unter dem Label State-Capacity dahingehend neu vermessen. Statt reflexhafter Abwehr braucht es ein Nachdenken darüber, was ein schlanker, aber leistungsfähiger Staat leisten muss. Denn Freiheit beruht nicht auf Institutionen an sich, sondern auf Institutionen, die liefern. Dabei geht es um den Schutz von Grundrechten und die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit – aber eben auch um alltägliche Dinge wie Bauprojekte, Behördenkontakte oder digitale Infrastruktur.
Ein schwacher Staat schützt die Freiheit nicht, er gefährdet sie. Wo der Staat nicht liefert, steigt die Anfälligkeit für autoritäre Versprechen. Gefragt ist deshalb kein allzuständiger Leviathan, sondern ein Staat, der das, was er übernimmt, gut macht. Estland zeigt, wie es gehen kann: digitale Verwaltung, transparente Prozesse, hohe Funktionalität. Der Kontakt mit dem Staat wird dort nicht als Belastung erlebt, sondern als Selbstverständlichkeit. Wenn sogar die neue Bundesregierung ein eigenes Ministerium für Staatsmodernisierung schafft und sich von liberalen Reformern wie Argentiniens Federico Sturzenegger inspirieren lässt, ist es Zeit für Liberale, mehr als nur Staatsschelte zu betreiben.
Liberale Erneuerung kann aufregend sein. Doch es braucht auch die Fackelträger der Flamme der Freiheit, wenn man so will.
Liberale Erneuerung kann aufregend sein. Doch es braucht auch die Fackelträger der Flamme der Freiheit, wenn man so will.
Dark Liberalism:
Die Freiheit der Konfrontation
Populismus hat den Liberalismus nicht nur politisch herausgefordert, sondern auch diskursiv entwaffnet. Während Populisten keine Scheu vor Freund-Feind-Denken, Identitätsnarrativen und Elitenverachtung zeigen, bleibt liberale Sprache oft zahm, prozedural, abstrakt. Dark Liberalism ist der Versuch, dieser Hilflosigkeit konfrontativ zu begegnen.
Hierfür hinterfragen (und verschieben) Dark Liberals das ihrer Ansicht nach naive liberale Gesellschaftbild: Das Politische ist nicht mehr lediglich der neutrale Rahmen für den Ausgleich pluraler Interessen, sondern ein Kampf um hegemoniale Vorherrschaft. Auch Gesellschaft wird nicht länger primär als Raum freiwilliger Kooperation begriffen, sondern als Schauplatz asymmetrischer Machtverhältnisse. Das bedeutet: Statt Rawls und Habermas werden Machiavelli, Gramsci und mitunter sogar Carl Schmitt rezipiert.
Bei alldem denkt man natürlich sehr schnell an Javier Milei. Auch Publizist Ulf Poschardt inszeniert Liberalismus als eine Art stilisierte Gegenkultur, rebellisch, trotzig, unangepasst. Die Grenzen zum Populismus werden bewusst unscharf gehalten. Doch der entscheidende Unterschied liegt im normativen Anspruch: Die liberale Ordnung wird nicht verworfen, sondern kämpferisch verteidigt. In der politischen Theorie ist dieser Ansatz noch kaum ausformuliert Doch er stellt die richtige Frage: Wie konfrontativ darf ein freiheitliches Projekt auftreten?
Thick Liberalism:
Der Charakter der Freiheit
Ganz im Kontrast zu solch konfrontativen Strömungen steht ein anderer Impuls: Der Wunsch nach einem holistischen Liberalismus, der mehr sein will als nur ein institutioneller Rahmen. Thick Liberalism verbindet politische Ordnung mit persönlicher Haltung. Dabei geht es um Tugenden wie Mut, Neugier oder Großzügigkeit. Und um die unbequeme Frage: Leben Liberale eigentlich, was sie predigen?
Auf den ersten Blick klingt das nach einer alten Debatte – etwa ob solche Vorstellungen vom „guten Leben“ nicht gegen das liberale Neutralitätsgebot verstoßen. Doch Werke wie „Freedom from Fear“ von Alan S. Kahan oder vor allem Alexandre Lefebvres „Liberalism as a Way of Life“ stoßen in eine andere Richtung. Sie fragen: Wird Liberalismus nur als politisches System verstanden oder auch als persönlicher Lebensentwurf? Damit trifft Lefebvre einen wunden Punkt. Denn irgendwie greift er damit auch die populistische Kritik auf: Predigen wir Chancengleichheit und schicken zugleich unsere Kinder auf Privatschulen? Fordern wir Weltoffenheit und Toleranz, ziehen aber allzu schnell die Grenzen des Sagbaren? Und sind die Vertreter des Liberalismus wirklich offen für Risiko, Extravaganz, Grenzüberschreitungen?
Gerade wer den politisch organisierten Liberalismus in Deutschland kennt, weiß: Das Lebensgefühl Freiheit ist nicht immer direkt spürbar. Thick Liberalism ist daher weniger politisches Programm als eine innere Reflexion der liberalen Denktradition. Eine Erinnerung daran, dass Liberalismus nicht nur gedacht, sondern gelebt werden muss. Und zwar von Menschen, die das Wagnis der Freiheit verkörpern.
Bausteine eines neuen Liberalismus
Bausteine eines neuen
Liberalismus
Ob Abundance, State-Capacity, Dark oder Thick Liberalism: Diese Strömungen sind keine fertigen Konzepte, sondern Bausteine einer liberalen Erneuerung. Sie widersprechen sich oft, ergänzen sich aber auch. Und sie zeigen vor allem eines: Liberalismus kann aufregend sein. Damit all dies kein intellektuelles Strohfeuer bleibt, braucht es kluge Köpfe, die die Ideen aufnehmen, im deutschen Kontext weiterdenken und letztlich in politische Wirklichkeit übersetzen. Fackelträger der Flamme der Freiheit, wenn man so will.

Sven Gerst ist Philosoph und ehemaliger Generalsekretär des internationalen Dachverbands der Liberalen Jugend IFLRY. Er hat Politische Ökonomie und Philosophie am King’s College London sowie an der London School of Economics studiert und einen Master in Management an der Universität Mannheim abgeschlossen.

Sven Gerst ist Philosoph und ehemaliger Generalsekretär des internationalen Dachverbands der Liberalen Jugend IFLRY. Er hat Politische Ökonomie und Philosophie am King’s College London sowie an der London School of Economics studiert und einen Master in Management an der Universität Mannheim abgeschlossen.
Auch interessant
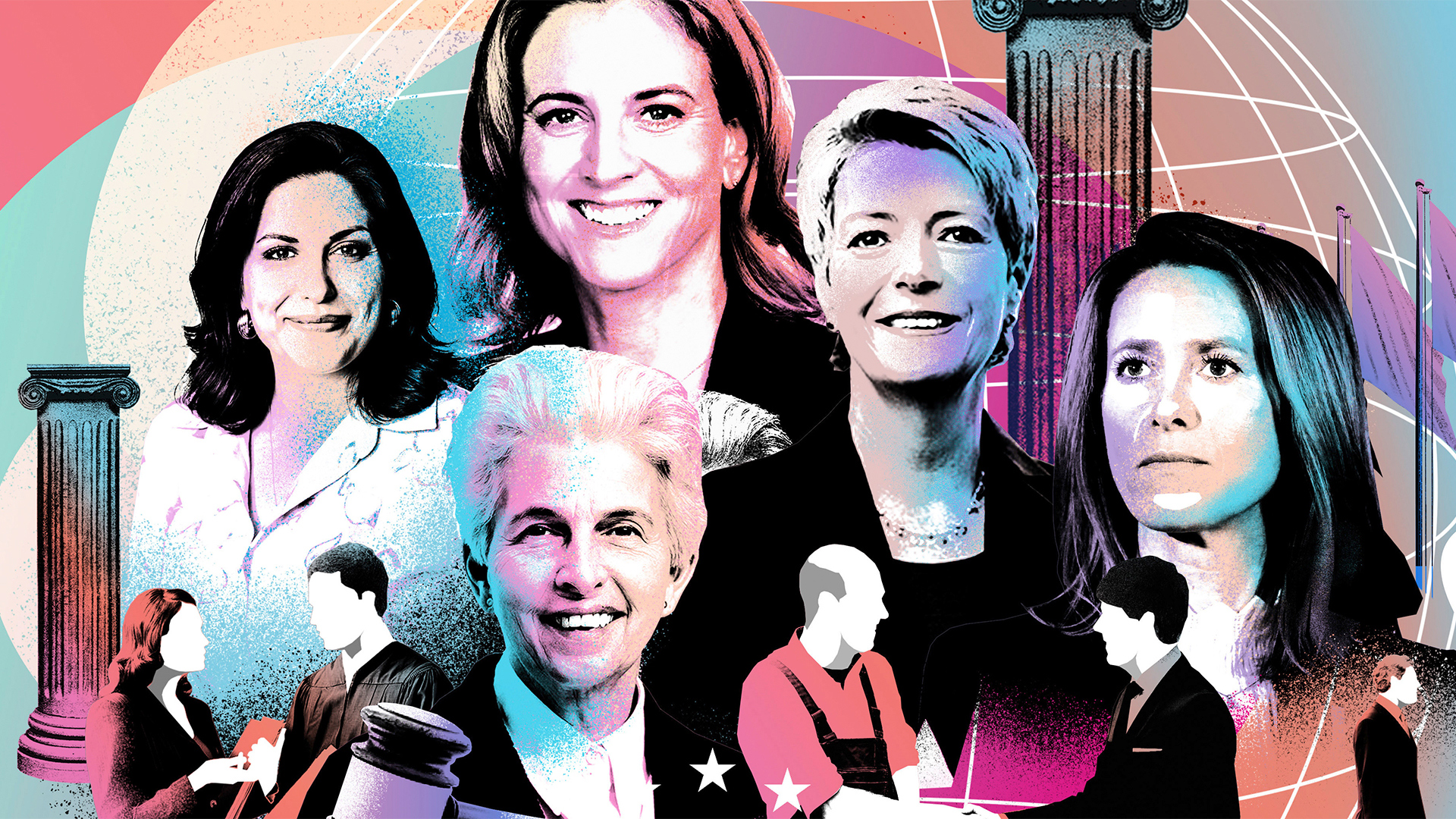
Julius von Freytag-Loringhoven, Julius Graack, Maja Sommerhalder // Kampf für Freiheit, Stärke und Demokratie
Wenn es um die Freiheit geht, wird es grundsätzlich. In dieser Welt sind Menschen liberal, wenn sie sich einsetzen für Freiheit, für Stärke, für ein Miteinander und für Respekt anderen gegenüber. Zum Glück für Europa sitzen hier fünf solcher Frauen an entscheidenden Schalthebeln der Macht.

Christoph Lixenfeld, Maximilian Münster // Bürgerschaftliches Engagement
Liberale Stärke zeigt sich vor Ort – in den Städten und Gemeinden. Vier Beispiele dafür, wie sich Menschen für andere einsetzen.

Thomas Ilka, Axel Novak // „Ich brenne für Inhalte“
Christian Dürr ist der neue Bundesvorsitzende der FDP. In einem seiner ersten Interviews nach der Wahl erklärt er, wie er die Partei erneuern will. Liberale Positionen und Ansätze sind für ihn unabdingbar, um das Land wieder voranzubringen.