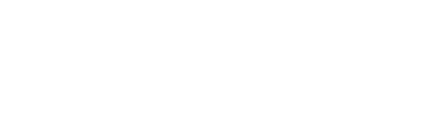Freihandel
EU-Mercosur-Abkommen
– Jetzt ratifizieren!
Freihandelsabkommen sind wichtig – gerade in einer Welt, in der immer mehr Handelsschranken aufgebaut werden. Zusammen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten hat die EU die größte Freihandelszone der Welt vereinbart. Ob sie Wirklichkeit wird, liegt nun vor allem an Italien und Argentinien.
Text: Hans-Dieter Holtzmann

Freihandel
EU-Mercosur-
Abkommen
– Jetzt ratifizieren!
Freihandelsabkommen sind wichtig – gerade in einer Welt, in der immer mehr Handelsschranken aufgebaut werden. Zusammen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten hat die EU die größte Freihandelszone der Welt vereinbart. Ob sie Wirklichkeit wird, liegt nun vor allem an Italien und Argentinien.
Text: Hans-Dieter Holtzmann

Nach drei Jahrzehnten Verhandlungen erfolgte im Dezember 2024 in Montevideo der Durchbruch: Die Präsidenten der vier Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay sowie die EU-Kommissionspräsidentin unterzeichneten feierlich ein Abkommen für eine große transatlantische Freihandelszone.
In Kraft ist das Abkommen damit noch nicht. Noch steht die Ratifizierung durch die Regierungen und Parlamente der EU und die Parlamente der Mercosur-Staaten aus. Nach der Überprüfung durch den „Juristischen Dienst“ und der Übersetzung in die EU-Amtssprachen dürfte der finale Text im Spätsommer vorliegen. Zumindest Teile des Abkommens könnten schon 2026 in Kraft treten.
Chance auf Wachstum
Mit dem EU-Mercosur-Abkommen würde die größte Freihandelszone der Welt für rund 750 Millionen Einwohner entstehen. Heute tauschen die beiden Regionen Waren im Wert von rund 88 Milliarden und Dienstleistungen für rund 40 Milliarden Euro im Jahr aus. EU-Unternehmen haben mehr als 300 Milliarden Euro im Mercosur investiert.
Das Abkommen will viele Handelshemmnisse abbauen. Mehr als 90 Prozent der Zölle werden abgeschafft – vor allem für den europäischen Auto- und Maschinenbau, aber auch die Chemie- und Pharmabranche wäre das relevant. Umgekehrt bietet das Abkommen der Landwirtschaft der Mercosur-Staaten einen leichteren Marktzugang in die EU. Außerdem besitzt Mercosur attraktive Rohstoffe wie Lithium, Nickel oder seltene Erden.
Ein wichtiger Bestandteil ist das Kapitel zum Thema Nachhaltigkeit und die Verpflichtung zum Pariser Klimaabkommen. Die Mitglieder verpflichten sich außerdem, illegale Abholzung zu bekämpfen und multilaterale Abkommen für Umweltschutz und Arbeitsstandards einzuhalten.
Tempo bei der Ratifizierung
Nun gilt es, eine qualifizierte Mehrheit im Rat zu sichern. Diese reicht aus, damit die handelspolitischen Teile des Abkommens vorläufig in Kraft treten können. Hierfür ist die Zustimmung von mindestens 55 Prozent der EU-Staaten erforderlich, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Das vorläufige Inkrafttreten von Handelsabkommen mittels qualifizierter Mehrheit ist ein Prozedere, das zum Beispiel bereits beim CETA-Abkommen mit Kanada angewandt wurde. Für eine Sperrminorität müssten mindestens vier Mitgliedstaaten gegen das Abkommen stimmen.
Bislang bestand der Eindruck, dass es für die Ratifizierung vor allem auf Brasilien, Frankreich und Deutschland ankäme. Deren Positionen erscheinen allerdings schwer vereinbar. Brasilien unterstützt das Abkommen. Präsident Lula da Silva steht bereits im Kontakt mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Beiden Ländern kommt in der zweiten Hälfte dieses Jahres eine Vermittlerrolle zu: Brasilien mit dem Vorsitz im Mercosur, Dänemark mit der europäischen Ratspräsidentschaft. In Deutschland gibt es eine breite Unterstützung für das Abkommen. Frankreich wiederum lehnt das Abkommen ab, weil es Nachteile für die Landwirtschaft befürchtet.
Dringlichkeit besteht, weil sich auch andere EU-Länder wie Österreich, Polen, die Niederlande und Irland skeptisch zum Abkommen geäußert haben, meist ebenfalls aus Sorge über die Auswirkungen auf ihre Landwirtschaft.
Für die Ratifizierung kommt es vor allem auf Italien und Argentinien an: In der EU nimmt Italien als drittgrößte Volkswirtschaft Europas eine Schlüsselrolle im Parlament und im Rat ein. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht das Abkommen skeptisch, lehnt es aber nicht zur Gänze ab.
Für die Ratifizierung kommt es vor allem auf Italien und Argentinien an: In der EU nimmt Italien als drittgrößte Volkswirtschaft Europas eine Schlüsselrolle im Parlament und im Rat ein. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht das Abkommen skeptisch, lehnt es aber nicht zur Gänze ab.
Die Studie zum EU-Mercosur-
Abkommen finden Sie HIER
Bislang bestand der Eindruck, dass es für die Ratifizierung vor allem auf Brasilien, Frankreich und Deutschland ankäme. Deren Positionen erscheinen allerdings schwer vereinbar. Brasilien unterstützt das Abkommen. Präsident Lula da Silva steht bereits im Kontakt mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Beiden Ländern kommt in der zweiten Hälfte dieses Jahres eine Vermittlerrolle zu: Brasilien mit dem Vorsitz im Mercosur, Dänemark mit der europäischen Ratspräsidentschaft. In Deutschland gibt es eine breite Unterstützung für das Abkommen. Frankreich wiederum lehnt das Abkommen ab, weil es Nachteile für die Landwirtschaft befürchtet.
Dringlichkeit besteht, weil sich auch andere EU-Länder wie Österreich, Polen, die Niederlande und Irland skeptisch zum Abkommen geäußert haben, meist ebenfalls aus Sorge über die Auswirkungen auf ihre Landwirtschaft.
Für die Ratifizierung kommt es vor allem auf Italien und Argentinien an: In der EU nimmt Italien als drittgrößte Volkswirtschaft Europas eine Schlüsselrolle im Parlament und im Rat ein. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht das Abkommen skeptisch, lehnt es aber nicht zur Gänze ab.
Die Studie zum EU-Mercosur-Abkommen finden Sie HIER
In Argentinien betont Präsident Javier Milei regelmäßig die Bedeutung von Freihandel für die Wirtschaft des Landes. Allerdings hat er auch wiederholt den Multilateralismus kritisiert, einschließlich Drohungen, das Pariser Klimaabkommen zu verlassen. Zudem ist Mileis Beziehung zum Mercosur belastet, aufgrund persönlicher Konflikte mit Lula, aber auch, weil er ein Freihandelsabkommen mit den USA anstrebt und sich hierin vom Mercosur behindert sieht.
Dabei bietet das Abkommen gerade für Italien und Argentinien große Chancen, wie eine neue Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gezeigt hat. Vor allem die Sektoren könnten profitieren, in denen beide Länder komparative Vorteile haben: Argentinien bei Lebensmitteln, Energie und Software, Italien bei Maschinen, Automobilen und Arzneimitteln. Hinzu kommen neue Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Verteidigung.
Dabei könnte hilfreich sein, dass fast die Hälfte der argentinischen Bevölkerung italienische Wurzeln hat. Bisher hat sich diese enge historische Verbindung jedoch nicht gleichermaßen in den Wirtschaftsbeziehungen niedergeschlagen: Der Handel zwischen den beiden Ländern macht gerade einmal 1,4 Prozent der argentinischen und 0,3 Prozent der italienischen Ausfuhren aus.
Politische Signale
Die wirtschaftlichen Vorteile allein garantieren jedoch nicht die Umsetzung des Abkommens. Hoffnung macht, dass Javier Milei und Giorgia Meloni eine freundschaftliche Beziehung verbindet, beide streben intensivere Beziehungen an. Ihre Unterstützung des Abkommens könnte auch eine Signal für andere Staaten sein, die mit der Zustimmung noch zögern.
Denn angesichts der unter Donald Trump schwieriger gewordenen transatlantischen Partnerschaft und für weniger wirtschaftliche Abhängigkeit von China, braucht Europa neue Freunde in der Welt. Das EU-Mercosur-Abkommen bietet hierfür eine historische Chance.

Hans-Dieter Holtzmann ist Projektleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit für Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay mit Sitz in Buenos Aires.

Hans-Dieter Holtzmann ist Projektleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit für Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay mit Sitz in Buenos Aires.
Auch interessant

Karl-Heinz Paqué // Das Ende des Generationenvertrags
Die Demographie lässt die Grundlagen der deutschen Sozialversicherung zerbröckeln. Wir brauchen einen Neubeginn mit tiefgreifenden Reformen.

Kira Brück // Bitte gründet hier!
Gründerinnen und Gründer mit Einwanderungsgeschichte sind Treiber für Wachstum und Innovation – und sie haben überdurchschnittlich oft einen Hochschulabschluss im MINT-Bereich. Aber Deutschland ist für sie oft nicht attraktiv genug. Wie könnte sich das ändern?
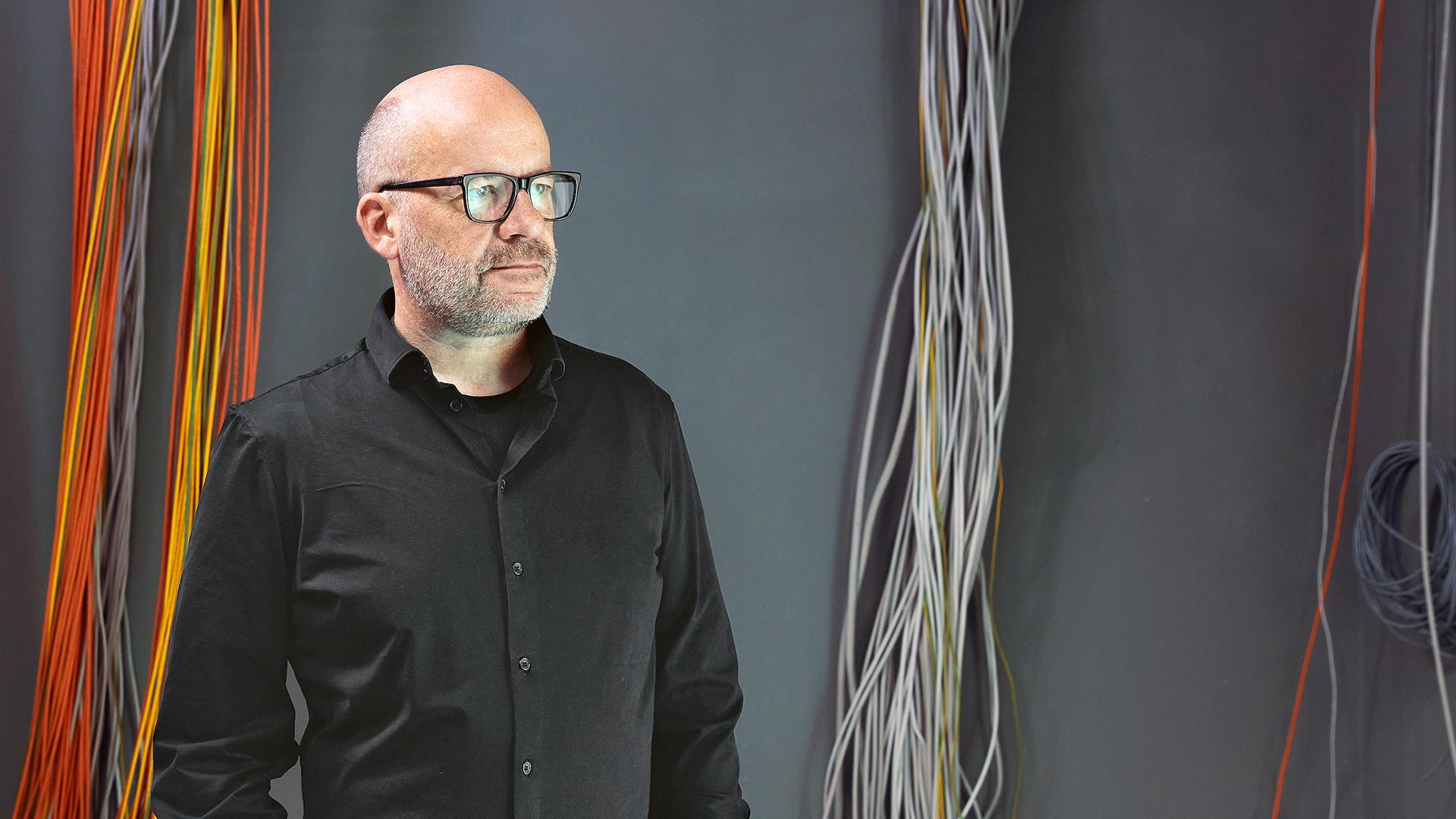
Axel Novak // Bildung – Mutter aller Innovationen
Die Weltpolitik brodelt, die Wirtschaft lahmt und die Stimmung ist düster. Dabei könnten die aktuellen Krisen eine echte Chance für Deutschland und Europa sein. Das sagt Rafael Laguna de la Vera, Chef der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND.