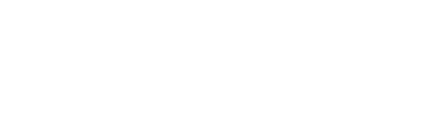Sozialer Zusammenhalt
Das Ende des
Generationenvertrags
Die Demographie lässt die Grundlagen der deutschen Sozialversicherung zerbröckeln. Wir brauchen einen Neubeginn mit tiefgreifenden Reformen.
Text: Karl-Heinz Paqué
Sozialer Zusammenhalt
Das Ende des
Generationen-
vertrags
Die Demographie lässt die Grundlagen der deutschen Sozialversicherung zerbröckeln. Wir brauchen einen Neubeginn mit tiefgreifenden Reformen.
Text: Karl-Heinz Paqué

Vor wenigen Wochen – im Mai 2025 – erschien ein wissenschaftliches Gutachten über die Zukunft der deutschen Sozialversicherung: Das Wissenschaftliche Institut der Privaten Krankenversicherung sagt den Niedergang der Sozialversicherung bis zur Mitte dieses Jahrhunderts voraus. Der Grund: mangelnde Finanzierbarkeit – wegen der demografischen Entwicklung, die immer höhere Beitragssätze für die jüngere, arbeitende Generation verlangt. Also eigentlich ein politischer Paukenschlag. Merkwürdig nur, dass die breitere Öffentlichkeit kaum Notiz davon nahm, obwohl der Hauptautor, der Ökonom Martin Werding, prominentes Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist. Die Diskussion beschränkte sich weitgehend auf die spezialisierten Wirtschaftsteile der Medien. Der Rest der Öffentlichkeit verschloss die Augen und Ohren.
Dabei enthält das Werding-Gutachten ein überzeugend begründetes Zahlenwerk, das schockiert: Je nach Annahmen wird die Generation der in jüngster Zeit (2020) Geborenen im Alter von 30 bis 40 Jahren Mitte des Jahrhunderts fast 60 Prozent ihres Einkommens für Beiträge zur Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung aufbringen müssen – im Vergleich zur Babyboomer-Generation der zwischen 1950 und 1970 Geborenen, die unter 40 Prozent zahlen. Das ist ein praktisch kaum mehr vorstellbares Belastungsniveau. Von einem funktionierenden „Generationenvertrag“ kann da eigentlich gar nicht mehr die Rede sein.
Fatale Dynamisierung
Der Grund ist einfach: Die junge Generation ist im Vergleich zu den Babyboomern viel zu klein, woran sich auch kaum etwas ändern lässt, weil Geburtenraten in einer modernen Gesellschaft sehr viel niedriger – und stabil niedriger – liegen als in der Zeit der Hochindustrialisierung. Wir sind in Deutschland eben auf der Rückseite des demografischen Berges angelangt. Und als wir noch mitten auf der Vorderseite waren, haben wir uns Reformen geleistet, die dafür sorgten, dass es auf der Rückseite bei der Finanzierung des Systems besonders düster aussehen wird. Vor allem die Dynamisierung der Renten, also deren mehr oder weniger automatische Angleichung an die Lohnerhöhungen, die Konrad Adenauer mit seiner CDU-geführten Regierung 1957 beschloss, sorgt bei stark schrumpfender Bevölkerung für ein Desaster, was übrigens schon damals kluge liberale Beobachter vorhersagten. Viele spätere Rentenanpassungen verschärften noch das Problem, bis zur aktuellen Mütter-Rente der CSU. Hinzu kam die Kostenexplosion im Gesundheitswesen durch die Alterung der Bevölkerung und den medizinischen Fortschritt, der willkommen, aber teuer ist.
Fatale Dynamisierung
Der Grund ist einfach: Die junge Generation ist im Vergleich zu den Babyboomern viel zu klein, woran sich auch kaum etwas ändern lässt, weil Geburtenraten in einer modernen Gesellschaft sehr viel niedriger – und stabil niedriger – liegen als in der Zeit der Hochindustrialisierung. Wir sind in Deutschland eben auf der Rückseite des demografischen Berges angelangt. Und als wir noch mitten auf der Vorderseite waren, haben wir uns Reformen geleistet, die dafür sorgten, dass es auf der Rückseite bei der Finanzierung des Systems besonders düster aussehen wird. Vor allem die Dynamisierung der Renten, also deren mehr oder weniger automatische Angleichung an die Lohnerhöhungen, die Konrad Adenauer mit seiner CDU-geführten Regierung 1957 beschloss, sorgt bei stark schrumpfender Bevölkerung für ein Desaster, was übrigens schon damals kluge liberale Beobachter vorhersagten. Viele spätere Rentenanpassungen verschärften noch das Problem, bis zur aktuellen Mütter-Rente der CSU. Hinzu kam die Kostenexplosion im Gesundheitswesen durch die Alterung der Bevölkerung und den medizinischen Fortschritt, der willkommen, aber teuer ist.
Enormer Reformbedarf
Was tun? Die Antwort kann nur lauten: Wir brauchen Reformen – schnellstmöglich und tiefgreifend. Die Anpassung des Rentenalters nach oben sowie die Zuwanderung von leistungsfähigen und leistungsbereiten jungen Menschen sind dabei wichtige, aber nur begrenzt wirksame Stellschrauben, die das Finanzierungsproblem ein Stück abfedern, aber nicht wirklich lösen. Das Kernproblem liegt im System selbst. Es beruht – so wie es konstruiert ist – fast ausschließlich auf der laufenden Finanzierung der Alten, Kranken und Arbeitslosen durch die Jungen, Gesunden und Beschäftigten (die Angelsachsen nennen so etwas „pay-as-you-go“-System). Es beruht jedenfalls nicht auf dem Rückgriff auf früher angespartes Vermögen, das zur eigenen Versorgung eingesetzt wird („funded“ System). Im letzten Bundestag setzte sich bis zuletzt die Fraktion der Freien Demokraten dafür ein, den ersten wesentlichen substanziellen Schritt zu einer gesetzlichen „Aktienrente“ gesetzlich zu beschließen. Dies scheiterte. In der neuen Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD ist davon nichts Wesentliches mehr zu sehen.
Dies wird sich rächen: Wenn bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode 2029 nichts geschieht, wird der Weg fortgesetzt in jene Welt der massiven Beitragsbelastung, die das Werding-Gutachten vorhersagt. Umso schlimmer werden die Schmerzen einer künftigen, unvermeidlichen Anpassung. Sie muss im Wesentlichen darin bestehen, dass die gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für eine private Vermögensbildung drastisch verbessert werden, um die unvermeidliche „Doppelbelastung“ der jungen Generation aus Finanzierung der Älteren und Vorsorge für das eigene Alter durch Vermögensbildung in Grenzen zu halten. Vor allem, aber nicht nur für die „demografischen Verlierer“, eben die junge Generation, müssen finanzielle Anreize geschaffen werden, möglichst stark in die private Vermögensbildung auf den Kapitalmärkten zu investieren, und zwar auch in jene Segmente des Marktes, die relativ hohe Erträge erzielen – bis hin zu großen Fonds in Risikokapitalmärkten, die durch kluge Diversifizierung der Anlagen auf lange Sicht stabil hohe Erträge ausweisen. Dazu bedarf es allerdings in Deutschland eines grundlegenden Wechsels der Mentalität. Vor allem muss das Vorurteil ausgeräumt werden, dass eine kapitalbasierte Rentenversicherung zwingend dafür anfällig sei, das Geld der Beitragszahler zu „verzocken“. Das ist, mit Verlaub, kompletter Unsinn, der sich allerdings vor allem im Spektrum der marktwirtschaftsskeptischen politischen Linken hartnäckig hält. Durch einen klugen Regulierungsrahmen lässt sich vor allem bei größeren Fonds sehr leicht ein Weg finden, damit einzelwirtschaftliche Risiken von Investitionen eben nicht die stabil hohe Rentabilität der Anlage gefährden. Dies gilt vor allem, wenn – wie bei der Altersvorsorge – langfristige Renditestrategien im Vordergrund stehen.
Wenn nun nichts geschieht,drohen die massiven Beitragsbelastungen, die das Werding-Gutachten vorhersagt.
Vorteil Aktienrente
Kurzum: Bei der liberalen Idee einer „Aktienrente“ im weitesten Sinn geht es nicht um irgendein kleines randständiges Instrument der Ergänzung der Altersvorsorge, sondern um ein fundamentales Reformkonzept, das zum zentralen Element einer zukunftsweisenden Reform der Sozialversicherung avancieren könnte. Dies hätte auch als Maßnahme der volkswirtschaftlichen Wachstumsförderung einen positiven Nebeneffekt: Deutschland könnte seine Finanzmärkte maßgeblich stärken – bis hin zu den Risikokapitalmärkten, die seit Langem ein Problemkind der deutschen Wirtschaftspolitik sind. Dies hätte auch positive Rückwirkungen für die globale Reputation des „Standort Deutschland“. Es wäre durchaus denkbar, dass dadurch ein Land mit einem notorischen Netto-Kapitalexport (und damit einem Leistungsbilanzüberschuss) endlich wieder eine Nation wird, die zum attraktiven Ziel von Finanzinvestitionen wird.
Es geht also bei der überfälligen Reform der Sozialversicherung um weit mehr als um die „Rettung“ eines Systems, das von konservativen Staatsmännern wie Bismarck und Adenauer geschaffen und erweitert wurde. Es geht um eine umfassende soziale und wirtschaftliche Erneuerung des Landes. Davon ist bei der neuen Bundesregierung so gut wie nichts zu spüren. Spätestens nach der nächsten Bundestagswahl 2029 muss sich dies grundlegend ändern.
Karl-Heinz Paqué ist Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Der studierte Volkswirt war von 2002 bis 2006 Landtagsabgeordneter und Finanzminister in Sachsen-Anhalt.
Karl-Heinz Paqué ist Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Der studierte Volkswirt war von 2002 bis 2006 Landtagsabgeordneter und Finanzminister in Sachsen-Anhalt.
Auch interessant
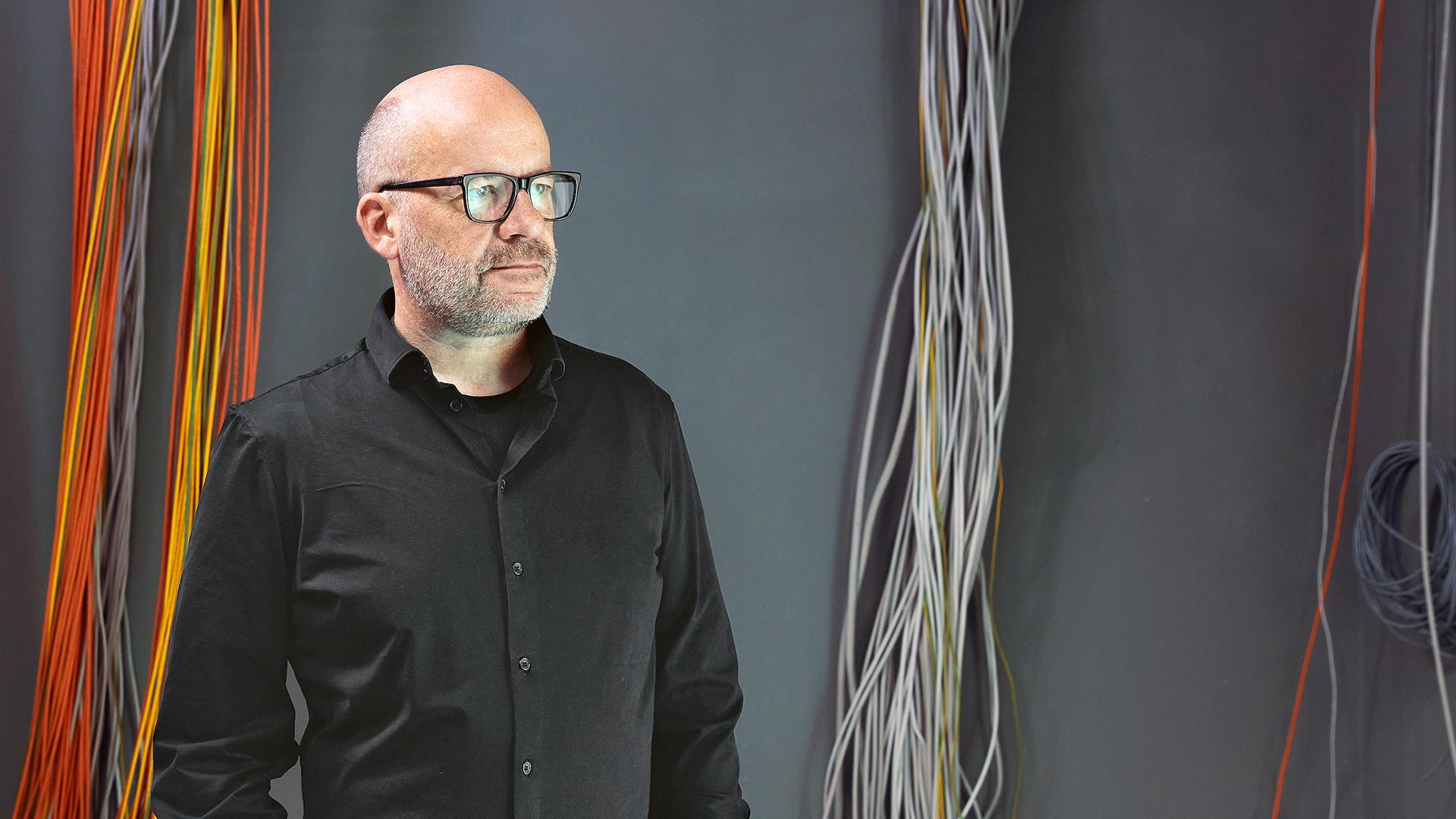
Axel Novak // Bildung – Mutter aller Innovationen
Die Weltpolitik brodelt, die Wirtschaft lahmt und die Stimmung ist düster. Dabei könnten die aktuellen Krisen eine echte Chance für Deutschland und Europa sein. Das sagt Rafael Laguna de la Vera, Chef der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND.

Kira Brück // Bitte gründet hier!
Gründerinnen und Gründer mit Einwanderungsgeschichte sind Treiber für Wachstum und Innovation – und sie haben überdurchschnittlich oft einen Hochschulabschluss im MINT-Bereich. Aber Deutschland ist für sie oft nicht attraktiv genug. Wie könnte sich das ändern?

Stefan Kolev // Mit der Gartenschere im liberalen Staat
Bei der Bundestagswahl ging es um vieles, aber kaum um vernünftige Wirtschaftspolitik. Jetzt ist es Zeit für die Liberalen, darüber nachzudenken, welche Aufgaben der Staat künftig übernehmen soll.